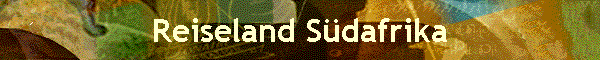
23.06.2008
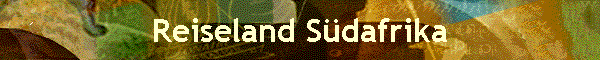
23.06.2008
 Südafrika, wildes Paradies
Südafrika, wildes Paradies
Franck
Fouquet - Eine Reise durch 24 Nationalparks · Vorwort: Johnny Clegg
„Die außergewöhnlichen Fotografien Franck Fouquets bezeugen die Schönheit meines
Landes, sie gehören zu den authentischsten, die ich je gesehen habe,“ so äußert
sich Johnny Clegg, der vielleicht populärste Sänger Südafrikas und engagierter
Kämpfer für die Abschaffung der Apartheid, in seinem Vorwort.
http://www.rvr-verlag.de/suedafrika_isbn3-938265-07-8_de.html
SPIEGEL
ONLINE - 15. Dezember 2003, 11:57
URL: http://www.spiegel.de/reise/fernweh/0,1518,278348,00.html
Südafrika
Nach Jahrzehnten der Haft in den Gefängnissen des südafrikanischen Apartheid-Regimes thront er heute als weltweit verehrte Autorität über allen Rassen und Religionen im Lande: Nelson Mandela. Seine Zelle auf Robben Island können Touristen ebenso besichtigen wie sein Heimatdorf und die dem ehemaligen Präsident gewidmeten Museen.
 Kapstadt/Umtata - Pinguine in Afrika? Wer die komischen Vögel
nur in antarktischen Gefilden vermutet, wird auf Robben Island eines Besseren
belehrt. Zu Tausenden bevölkern sie dort die steinige Küste. Die Schüler, die
gerade den für schwarze Südafrikaner obligatorischen Ausflug nach Robben Island
absolvieren, setzen ihnen lautstark nach, und mancher weit gereiste Tourist
ärgert sich über die lange Reaktionszeit seiner Digitalkamera. Für einen Moment
haben sie alle vergessen, warum sie eigentlich mit der Fähre von Kapstadt aus
herüber gekommen sind: Die Gefängnisinsel Robben Island ist für sie eine
wichtige Station auf einer Reise auf den Spuren Nelson Mandelas.
Kapstadt/Umtata - Pinguine in Afrika? Wer die komischen Vögel
nur in antarktischen Gefilden vermutet, wird auf Robben Island eines Besseren
belehrt. Zu Tausenden bevölkern sie dort die steinige Küste. Die Schüler, die
gerade den für schwarze Südafrikaner obligatorischen Ausflug nach Robben Island
absolvieren, setzen ihnen lautstark nach, und mancher weit gereiste Tourist
ärgert sich über die lange Reaktionszeit seiner Digitalkamera. Für einen Moment
haben sie alle vergessen, warum sie eigentlich mit der Fähre von Kapstadt aus
herüber gekommen sind: Die Gefängnisinsel Robben Island ist für sie eine
wichtige Station auf einer Reise auf den Spuren Nelson Mandelas.
Robben Island ist ein Mythos, berüchtigt wie Alcatraz in der Bucht von San Francisco. Aber Robben Island steht für mehr als spektakuläre Fluchtversuche - die Insel ist ein Symbol für die Schrecken des südafrikanischen Apartheid-Regimes. Die Elite des schwarzen Widerstands war hier inhaftiert, allen voran Nelson Mandela, der Führer des African National Congress (ANC). 18 seiner insgesamt 27 Haftjahre hat er hier verbracht, in einer Zelle, deren Breite gerade ausreichte, um eine Matte zum Schlafen auf den kalten Zementboden zu legen. Zweieinhalb Stunden dauern die geführten Touren auf Robben Island.
Die Geschichte hat Robben Island bekanntlich ein Happy End beschert. Sie hat das Apartheid-Regime hinweggefegt und die Häftlinge über ihre Peiniger triumphieren lassen. Einige von ihnen arbeiten heute als Touristenführer im Gefängnistrakt, andere hat der Umschwung in höchste Ämter getragen. Nelson Mandela wurde nicht nur Präsident Südafrikas, sondern thront als weltweit verehrte Autorität heute über allen Rassen und Religionen im Lande.
 Wer wissen will, wo dieser Lebensweg begonnen hat, muss die
ausgetrampelten Touristenpfade hinter sich lassen. Rund drei Tagesreisen mit dem
Mietwagen liegen zwischen Kapstadt und East London in der Ostkap-Provinz. Im
weiteren Verlauf der Autobahn N2 erreicht der Fahrer eine Hügellandschaft von
beeindruckender Schönheit, die dennoch bei manchen Südafrikanern als
gefährliches Terrain, als "No-go-area" gilt: die Transkei, Heimat Nelson
Mandelas, von 1976 bis 1994 ein unabhängiges Homeland und noch heute fast
vollständig von Angehörigen des Xhosa-Volkes bewohnt.
Wer wissen will, wo dieser Lebensweg begonnen hat, muss die
ausgetrampelten Touristenpfade hinter sich lassen. Rund drei Tagesreisen mit dem
Mietwagen liegen zwischen Kapstadt und East London in der Ostkap-Provinz. Im
weiteren Verlauf der Autobahn N2 erreicht der Fahrer eine Hügellandschaft von
beeindruckender Schönheit, die dennoch bei manchen Südafrikanern als
gefährliches Terrain, als "No-go-area" gilt: die Transkei, Heimat Nelson
Mandelas, von 1976 bis 1994 ein unabhängiges Homeland und noch heute fast
vollständig von Angehörigen des Xhosa-Volkes bewohnt.
Man solle keinesfalls anhalten und aussteigen, nicht einmal um Unfallopfern zu helfen, hatte die besorgte Herbergsmutter in Kapstadt geraten - mit dem gleichen Tipp warten auch ganz seriöse Reiseführer auf. Doch dann steht da am Straßenrand neben einem uralten Toyota dieser gestrandete Autofahrer, der verzweifelt mit einem Benzinkanister winkt. Er wirkt vertrauenswürdig genug, um alle Warnungen in den Wind zu schlagen und ihn bis zur nächsten Tankstelle mitzunehmen. Dort bedankt er sich überschwänglich: "Niemand hält mehr an, alle sind so misstrauisch geworden in Südafrika."
Kurz vor Umtata, der Hauptstadt der Transkei, liegt links der N2 das Dörfchen Qunu. Es unterschiedet sich mit seinen bunten Häuschen und Rundhütten inmitten des baumlosen Graslandes durch nichts von anderen Siedlungen entlang des Weges, ein Schild weist den Weg zum Nelson-Mandela-Museum. Nach Qunu kam Mandela als Zweijähriger aus dem 30 Kilometer entfernten Ort Mvezo, nachdem die weiße Obrigkeit seinem Vater wegen Aufsässigkeit die Häuptlingswürde entzogen hatte. "In Qunu lebten wir in einem bescheidenen Stil, doch verbrachte ich dort einige der glücklichsten Jahre meiner Knabenzeit", schreibt er in seiner Autobiografie "Der lange Weg zur Freiheit".
 Qunu und der Geburtsort Mvezo sind heute Außenstellen des
Museums, das seinen Hauptsitz in Umtata hat. Beide Dörfer bergen eine ganze
Reihe authentischer Pilgerstätten für Mandela-Bewunderer: die Grundmauern seines
Geburtshauses, das Familiengrab, die Taufkirche und die Reste der Grundschule,
in der er den Namen Nelson erhielt. Mandela ist in Qunu aber nicht nur geistig
präsent, sondern oft auch leibhaftig. Am südlichen Ortsrand ließ er sich nach
dem Ende der Apartheid seinen Alterssitz errichten, in dem er sich regelmäßig
aufhält.
Qunu und der Geburtsort Mvezo sind heute Außenstellen des
Museums, das seinen Hauptsitz in Umtata hat. Beide Dörfer bergen eine ganze
Reihe authentischer Pilgerstätten für Mandela-Bewunderer: die Grundmauern seines
Geburtshauses, das Familiengrab, die Taufkirche und die Reste der Grundschule,
in der er den Namen Nelson erhielt. Mandela ist in Qunu aber nicht nur geistig
präsent, sondern oft auch leibhaftig. Am südlichen Ortsrand ließ er sich nach
dem Ende der Apartheid seinen Alterssitz errichten, in dem er sich regelmäßig
aufhält.
Eines der Gebäude folgt im Inneren dem Grundriss seines letzten Gefängnisses Victor Verster nordöstlich von Kapstadt, in das er 1988 verlegt wurde - eine Anhänglichkeit, die aber nicht auf ein Trauma schließen lässt. Mandela hatte sich nach eigener Aussage schlicht an die Abmessungen des Gebäudes gewöhnt. Zudem handelte es sich bei Victor Verster um eine echte Luxusunterkunft, und das nicht nur gemessen an Robben Island. Mandela standen mehrere Schlafzimmer, ein Fitnessraum und ein Swimmingpool zur Verfügung. Das Gebäude in der Nähe des Weinortes Paarl kann inzwischen ebenfalls besichtigt werden.
 Während man sich schwer vorstellen kann, dass in die
verschlafene Ländlichkeit von Qunu jemals Touristenmassen einbrechen werden, ist
das Nelson-Mandela-Museum in Umtata an regen Besucherverkehr gewöhnt. Unter den
ausländischen Eintragungen im Gästebuch bilden deutsche Adressen die größte
Gruppe. International, wenngleich nicht immer künstlerisch wertvoll, sind auch
die Geschenke, die Mandela nach seiner Freilassung von Staatsmännern und
Privatleuten erhalten hat. In den Seitenflügeln des Museums sind sie zu
bestaunen. Die Hauptausstellung widmet sich dem Lebensweg Mandelas, den sie mit
Fotos und Zitaten aus der Autobiografie illustriert.
Während man sich schwer vorstellen kann, dass in die
verschlafene Ländlichkeit von Qunu jemals Touristenmassen einbrechen werden, ist
das Nelson-Mandela-Museum in Umtata an regen Besucherverkehr gewöhnt. Unter den
ausländischen Eintragungen im Gästebuch bilden deutsche Adressen die größte
Gruppe. International, wenngleich nicht immer künstlerisch wertvoll, sind auch
die Geschenke, die Mandela nach seiner Freilassung von Staatsmännern und
Privatleuten erhalten hat. In den Seitenflügeln des Museums sind sie zu
bestaunen. Die Hauptausstellung widmet sich dem Lebensweg Mandelas, den sie mit
Fotos und Zitaten aus der Autobiografie illustriert.
Mandela als überlebensgroße Führer- und Heilsfigur - diese bislang nur symbolische Rolle könnte in Kürze materielle Gestalt annehmen, wenn auch nicht in der Transkei, sondern in der günstiger gelegenen Hafenstadt Port Elizabeth an der Grenze zum Westkap. Dort plant ein Geschäftsmann den Bau eines gigantischen Mandela-Denkmals, das selbst die Freiheitsstatue von New York in den Schatten stellen soll.
Rundherum soll sich ein Freizeitpark gruppieren, der die "Big Five" - Elefant, Löwe, Leopard, Büffel und Nashorn - und andere nicht ganz ortstypische Attraktionen zusammenführt: ein "Best of South Africa" kurz hinter dem Ende der Gartenroute. "Madiba Bay" heißt das Projekt in Anlehnung an den Clannamen Mandelas. Schon zuvor hat sich die Region um Port Elizabeth, die fünftgrößte Stadt des Landes, werbewirksam in "Nelson Mandela Bay" umbenannt. "Mit Sicherheit ist Port Elizabeth nicht der Höhepunkt einer Südafrikareise", heißt es abschätzig in einem Reiseführer. Das soll sich nach Wunsch der Planer ändern, schließlich hat Mandela schon ganz andere Wunder vollbracht.
Von Tobias Wiethoff, gms
Zum Thema:
|
In SPIEGEL ONLINE: |
|
|
Gefängnisinsel Robben Island
Von Michael Bitala und Antonin Kratochvil (Fotos)
Auf Robben Island sperrten Südafrikas Rassisten ihre politischen Gefangenen ein, Nelson Mandela und Tausende andere. Heute führen die Häftlinge von einst stolz Touristen über die Insel. Sie ist das Symbol für den Sieg über die Apartheid.
Wenn sie dürften, würden sie es bestimmt gerne einmal machen. Nur so, zum
Spaß, der Echtheit zuliebe. Die schwarzen Fremdenführer würden Wärter spielen
und die überwiegend weißen Besucher vom Boot scheuchen. Sie würden sie am Kai
zusammentreiben und ihnen Hand- und Fußfesseln anlegen. Vielleicht nähmen sie
ihnen auch noch die Schuhe und die Socken weg, die dicken Jacken und Pullover.
Und dann würden sie sie durchzählen lassen: 54697/05, 54698/05, 54699/05,
54700/05 und so weiter. So wie das früher eben mit den Gefangenen gemacht wurde.
Und weil sich die Touristen beim Zählen vermutlich gar so anstellten, müssten
sie das Ganze wiederholen. 54697/05, 54698/05, 54699/05. "Wie bescheuert seid
ihr eigentlich?", würden die Fremdenführer schreien, "nicht mal anständig zählen
könnt ihr!" Und wenn sich die Besucher über diesen Empfang beschwerten, dann
hieße es nur: "Hört mal, Kaffern und Kulis, das hier ist kein
Fünf-Sterne-Hotel." Auch das war ein beliebter Spruch auf Robben Island.
Natürlich machen sie es nicht. Auf der berüchtigten Kerkerinsel vor Kapstadt
wird heute niemand mehr gefesselt, niemand mehr gedemütigt, niemand mehr
eingesperrt. Aber einige Touristenführer hätten durchaus Gefallen an dieser Idee
- nicht weil sie böse Menschen wären, das nicht, aber eine Spur Sarkasmus haben
sie alle. Da gibt es zum Beispiel Sipho Nkosi, einen älteren Herrn mit
kugelrundem Bauch und sehr zittrigen Händen. "Willkommen auf Robben Island",
sagt er zur eben eingetroffenen Gruppe, "Sie werden diese Gefängnisinsel nie
wieder verlassen." Und dann lacht er am lautesten, weil ihn die Touristen
verwirrt anstarren.
Wie kann der Mann solche Witze machen? Mit solch einer Vergangenheit? Erst 1990
bekam Sipho Nkosi seine Freiheit und seinen Namen zurück, in den Jahren zuvor
war er 78/86. Das war seine Nummer auf Robben Island, weil er als 78. Gefangener
im Jahr 1986 auf der Insel ankam. "78/86", sagt Nkosi während der Führung immer
wieder, "die Wärter nannten mich nur 78/86, sie haben mir selbst meinen Namen
gestohlen."
Wenn es einen Ort am Kap der Guten Hoffnung gibt, der durch und durch verstörend
ist, dann ist das Robben Island. Kein Ausflugsziel wartet mit so vielen
Überraschungen, so vielen Verwirrungen, so viel historischem Irrsinn auf wie
dieses elf Kilometer vor der Küste von Kapstadt liegende Eiland. Es fängt damit
an, dass heute ehemalige Häftlinge als Fremdenführer dort arbeiten, manche von
ihnen wohnen sogar auf der Insel. Was aber hält sie freiwillig an einem Ort, an
dem sie jahrelang, oft auch jahrzehntelang eingesperrt waren, gedemütigt und
gefoltert wurden? Sipho Nkosi jedenfalls mag diese Frage nicht wirklich
beantworten, er sagt nur: "Die Leitung des Robben-Island-Museums hat mich
gebeten, das zu machen. Sie sagten, ich würde mich auf der Insel auskennen."
Hat er keinen Drang, diesen Ort ein für allemal zu verlassen? "Es ist ein
schwieriger Job", sagt der Ex-Häftling, und schon treibt er die Besucher weiter
durchs Gefängnis: zwei Minuten in den Hof, wo auch er einst Steine klopfen
musste; drei Minuten in den Raum der Zensoren, die die Briefe der Gefangenen
nahezu komplett geschwärzt haben; zwei Minuten in die schäbigen Duschen, in
denen es lange Zeit nur eiskaltes Wasser gab. Und dann geht es noch vier Minuten
in die heilige Zelle - anders kann man das Loch nicht bezeichnen, in dem der
berühmteste Häftling, Nummer 466/64, 18 Jahre lang inhaftiert war.
Es ist ein winziger, kahler Raum, gerade zwei mal zwei Meter groß. Eine Matte
und drei Filzdecken liegen am Boden, ein dunkelbrauner Blecheimer ist die
ausgediente Toilette, und an der Wand hängen drei Metallkästen. Dort durfte
Nelson Mandela in den letzten Jahren seiner Gefangenschaft Bücher verstauen. Bis
auf das Klicken einiger Kameras herrscht Stille. 55 Touristen und kein Wort. So,
als ob sie den heiligen Schrein betreten hätten, so, als ob sie darauf warteten,
dass der heilige Geist der Freiheit auf sie niederkomme. Ex-Häftling Nkosi aber
scheucht die Besucher weiter. "Sie können jetzt noch hinüber zu den Pinguinen
oder sich eine Cola kaufen, aber beeilen Sie sich, das Boot fährt in 15 Minuten
nach Kapstadt zurück."
Begrüßung, Inselrundfahrt, Hochsicherheitstrakt, Mandela-Zelle, Pinguine,
Cola - so sieht die zweieinhalbstündige Führung auf Robben Island aus.
Dazwischen gibt es Horrorstorys aus der Apartheidzeit und ein paar Scherze der
ehemaligen Gefangenen. "Ist ein Tourist aus Holland dabei?", fragt zum Beispiel
Fremdenführer Reginald Ahrens. Einer meldet sich. "Warum kommt ihr Holländer
immer noch nach Südafrika? Glauben Sie, Ihre Buren-Verwandtschaft hätte uns
nicht schon genug gequält?" Alle lachen, nur der Holländer blickt verwirrt.
Vom Schrecken der Insel, vom Sadismus der Wärter, von der Verzweiflung der
Gefangenen bekommt man bei solchen Touren nicht viel mit. Und von der Geschichte
der Insel natürlich auch nicht. Man darf keinen Schritt außerhalb der Gruppe
machen und keine Minute länger bleiben. All zu viel Freiheit gibt es auf der
ehemaligen Gefängnisinsel auch heute noch nicht.
Man muss sich Robben Island also anders nähern. Man sollte telefonieren und Geld
ausgeben. Für 2000 südafrikanische Rand, das sind 250 Euro, erklärt sich zum
Beispiel der ehemalige Häftling 885/63 bereit, eine Privatführung zu machen.
885/63, das ist Indres Naidoo. Der Mann hat einen langen Pferdeschwanz,
indische Gesichtszüge und schwarze Haut. Mit seiner Lederjacke aus Magdeburg
sieht er aus wie 50, im kommenden Jahr wird er 70. Auffällig ist auch, wie
unbeschwert er wirkt, wie oft er lacht und Scherze macht. Von 1963 an war er
zehn Jahre auf Robben Island inhaftiert, weil er bei einem versuchten Anschlag
auf ein Eisenbahnstellwerk erwischt wurde. Er war einer der ersten politischen
Gefangenen auf der "Teufelsinsel", wie er sie nennt, einer derjenigen, die die
größten Torturen erleiden mussten.
Nachdem das Apartheidregime Robben Island 1960 zur Haftanstalt für farbige und
schwarze Gegner gemacht hatte, konnte es die Häftlinge dort nahezu unbeobachtet
von der Welt quälen. Diese mussten in den ersten Jahren in täglicher
Zwangsarbeit das neue Hochsicherheitsgefängnis bauen. "Wir haben das so solide
gemacht", sagt Naidoo, "dass wirklich niemand mehr von uns fliehen konnte."
Erst nach ein paar Jahren wachte die internationale Gemeinschaft auf und übte
Druck aus, erst danach gab es Hafterleichterungen wie sporadische
Kinovorführungen oder wärmere Decken. Indres Naidoo hat sein Martyrium
aufgeschrieben, "Insel in Ketten" heißt seine Erinnerung, und die Lektüre dieser
300 Seiten ist ein einziger Schrecken. Bei so vielen Verletzungen, bei so vielen
Schmerzen ist es ein Wunder, dass der Mann noch lebt. "Unsere Wärter sagten
immer: Ihr werdet dieses Gefängnis nicht mehr lebend verlassen. Davor hatten wir
wirklich Angst."
Am Tag der Menschenrechte, am 10. Dezember 1963, wurde Indres Naidoo nach Robben
Island gebracht, mit dem Boot "Dias", das heute noch im Hafen der Kapstädter
Waterfront ankert. Gehört hatte Naidoo von der Insel vieles, vor allem
Grausames: "Ich dachte, wir kommen ins südafrikanische Alcatraz, auf eine
hässliche, graue, trostlose Insel." Doch so wie Häftling 885/63 vor 42 Jahren
verwundert war, wundern sich heute noch Touristen. Robben Island ist
wunderschön, das Eiland erinnert eher an eine Nordseeinsel als an einen Ort der
Tyrannei. Schon vom Boot aus ist der rot-weiß gestrichene Leuchtturm zu sehen,
die weiße, in den Himmel strebende anglikanische Kirche und die ehemalige
Residenz des Gouverneurs.
Es ist ein prächtiges Kolonialgebäude, das heute als Gästehaus benutzt wird,
auch Nelson Mandela hat dort schon übernachtet. Gäbe es also diese graue
Gefängnisanlage, die hohen Mauern, die Wachtürme und den vielen Stacheldraht
nicht, wäre Robben Island eine der schönsten Inseln des Landes, mit Dutzenden
von Vogelarten, mit Pinguinen, Robben, Antilopen, Schildkröten und Perlhühnern.
Mit ein wenig Glück kann man Wale oder Delfine sehen.
Doch auf Robben Island lag bis 1994, bis zum Ende der Apartheid und der
Schließung des Gefängnisses, ein Fluch, einer, den die weißen Eroberer vor
Jahrhunderten über sie gebrachten haben. Der Portugiese Bartolomeu Dias war der
erste Europäer, der die Insel 1488 für die Weißen entdeckte. Zunächst diente sie
als Basis, um Seehunde zu fangen, oder auch als Poststation. Auf dem Seeweg von
Europa nach Südostasien hinterließen Matrosen unter Steinen ihre Briefe in
ölgetränkten Tüchern. Auf diesen "Poststeinen" waren die Namen der Schiffe
eingraviert, für die die Nachrichten bestimmt waren, außerdem Route, Datum der
Ankunft und der Abfahrt sowie der Kapitänsname. Ansonsten war das Eiland vor
allem Nahrungsreservoir. 1601 wurden zum Beispiel zwei Klippschliefer
ausgesetzt, merkwürdige Wesen, die aussehen wie kaninchengroße Hamster, aber
Elefanten als engste Verwandte haben. Und sie vermehrten sich ähnlich schnell
wie die ausgesetzten Hasen. Somit wurden sie und die auf Robben Island lebenden
Fettschwanzschafe und Rinder zum Frischfleischvorrat für die Matrosen.
1614 aber war es mit der Idylle vorbei. Damals besiegelte die English East India
Company das Schicksal der Insel. Sie beauftragte Sir Thomas Herbert, eine
Siedlung für Bauern zu bauen, mit zehn Häftlingen. Damit war die Idee geboren,
Robben Island nicht nur landwirtschaftlich, sondern auch als Gefängnis zu
nutzen. 1636 sperrten die Briten die Anführer eines Aufstands dort ein, zwei
Jahrzehnte später schickte der Holländer Jan van Riebeeck seinen Übersetzer
Autshumao und zwei weitere Khoikhoi nach Robben Island in die Verbannung.
Dutzende von Stammesführern und Königen aus Südafrika wurden auf der Insel
eingesperrt, die Holländer brachten selbst noch aus Indien, Malaysia und
Indonesien politische Gefangene.
Diese Liste könnte lange fortgesetzt werden, aber man kann es auch so
ausdrücken, wie es die meisten Historiker heute tun: Robben Island wurde zur
"Müllkippe" der Kolonialisten und Rassisten. Ob Verbrecher, Prostituierte,
Leprakranke, Blinde, Kriegsgefangene oder politische Gegner - all diejenigen,
die isoliert, versteckt oder eingesperrt werden sollten, landeten auf dem 574
Hektar großen Eiland.
Wenn man mit dem Ex-Häftling Indres Naidoo über die Insel läuft, erzählt er von
seinen Qualen. Jeden Tag gab es Prügel, Erniedrigungen, Gebrüll von weißen
Wärtern. Im wenigen Essen tummelten sich Würmer, Insekten und Maden, im
Kalksteinbruch, wo sie schuften mussten, schnitten sie sich am scharfkantigen
Geröll die Füße auf, und wenn sie auf die Toilette mussten, dann gab es meist
nicht einmal Klosettpapier. Nachts kamen die Alpträume, die eisige Kälte, der
Hunger, die unendliche Einsamkeit. Und immer wieder wurde Naidoo auch in
Isolationshaft gesteckt, immer wieder wurde er gefoltert oder mit dem Rohrstock
verprügelt. Den Erzfeinden der Apartheid sollte das Rückgrat gebrochen werden.
Die Wärter schimpften die Schwarzen "Kaffern", Inder wie Naidoo waren "Kulis".
Der ehemalige Häftling erzählt, wie nah die Freiheit oft schien. Vor allem an
der Stelle, wo heute Tausende von Pinguinen brüten, hat man einen
überwältigenden Blick auf den Tafelberg, es scheint, als liege kein Meer
zwischen Robben Island und Kapstadt. Doch das azurblaue Wasser ist nicht nur
voll mit Haien, es ist auch das ganze Jahr über bitterkalt, selbst im Sommer,
wenn sich die Luft auf 35 bis 38 Grad aufheizen kann, hat es wegen der
antarktischen Strömung nur 13 oder 14 Grad.
Natürlich hat es trotzdem Ausbruchsversuche gegeben, mit Booten, die aus
Tierfellen gebaut waren, mit Planken oder einfach dadurch, dass Inhaftierte ins
Wasser stiegen und davonschwammen. Die meisten starben, aber die Behauptung des
Apartheidregimes, dass all die Geflohenen ertrunken, erfroren oder von Haien
gefressen worden sind, stimmt sicherlich nicht. Viele der Häftlinge, die es
versucht haben, sind einfach in der Anonymität verschwunden. Und dass man es
schaffen kann, bewies die 15-jährige Peggy Duncan schon 1926, als sie die elf
Kilometer lange Route nach Kapstadt in neun Stunden und 25 Minuten schwamm. Das
Problem der meisten schwarzen und farbigen Häftlinge während der Apartheid war
nur, sagt Indres Naidoo, "dass kaum einer von uns schwimmen konnte; das wussten
auch die Rassisten".
Es geht zurück zum Schnellboot, das nach Jan van Riebeecks verbanntem Übersetzer
Autshumao benannt ist, und Naidoo redet und redet und redet. Als ob er jedes
Detail seiner Tortur loswerden möchte. Nach zehn Jahren Haft nahm er den Kampf
gegen die weißen Rassisten wieder auf, zunächst im Exil in Mosambik und Sambia,
später als Gesandter des African National Congress in Ost-Berlin. Er hat mehrere
Attentatsversuche überlebt und wurde nach der Unabhängigkeit Südafrikas Senator
der ANC-Regierung. Heute lebt er als Rentner in Kapstadt und kann von seiner
Terrasse aus Robben Island sehen. Beim Ablegen der "Autshumao" gibt es einen
seltsamen optischen Effekt, den Indres Naidoo in seinem Buch so beschreibt: "Die
Insel scheint größer zu werden, je weiter wir uns von ihr entfernen. Zuerst
sehen wir nur die kleine Hafenanlage, dann die Felsen und Sträucher zu beiden
Seiten und schließlich die ganze, ausgedehnte Küstenlinie, eine vollständige
Insel, ein grünes, malerisches Stück Land im Ozean. Die grausame Monotonie ihres
inneren Lebens ist völlig verborgen hinter der äußeren natürlichen Schönheit."
Zum Abschied eine letzte Frage: War es nicht entsetzlich, als Indres Naidoo 1994
die Insel zum ersten Mal wieder betreten musste? "Nein, ganz und gar nicht",
sagt er, "es war fantastisch." Als Nelson Mandela zum Staatspräsidenten gewählt
worden war, lud dieser all die ehemaligen politischen Gefangenen nach Robben
Island ein, von 1960 bis 1990 waren immerhin 3000 Männer dort inhaftiert. Und
das Wiedersehen, sagt Naidoo, sei "eine einzige Freude" gewesen. Während der
Haft nämlich, mit jedem Widerstand, mit jedem Hungerstreik, mit jeder erkämpften
Erleichterung, sei der Zusammenhalt der Gefangenen noch enger geworden. "Das gab
uns eine enorme Kraft, das verbindet uns ein Leben lang." Und gerade weil sie ja
den Kampf gewonnen haben, gerade weil diese Insel heute der Inbegriff des
Erfolgs sei, mache es auch vielen ehemaligen Häftlingen nichts aus, dort als
Fremdenführer zu arbeiten. "Wir können all die Besucher doch voller Stolz
herumführen."
Zum Treffen mit Mandela auf Robben Island waren übrigens auch die ehemaligen
Wärter eingeladen, doch nur ganz wenige erschienen, diejenigen eben, mit denen
die Häftlinge über die Jahre hinweg Freundschaften aufgebaut haben. Alle anderen
blieben weg. "Viele Aufseher haben nach der Unabhängigkeit einen anderen Namen
angenommen und sind abgetaucht. Die haben Angst vor uns", sagt Naidoo, "die
glauben, dass wir Rache nehmen wollen. Dabei hätten wir uns wirklich gefreut,
sie zu sehen."
Johannesburg
Von Roman Heflik, Johannesburg
Johannesburg, chaotische Metropole im Touristenland Südafrika, bereitet sich auf den ersten nationalen autofreien Tag vor. Damit wollen die Behörden für Busse und Bahnen werben. Die Bewohner von "Joburg" reiben sich verwundert die Augen: Was für Busse und Bahnen?
Eigentlich hatte Ignatius Jacobs den Morgenzug von Soweto ins nahe Johannesburg nehmen, dort mit einem der üblichen Minibus-Taxis ein bisschen herumfahren und schließlich einen Linienbus zurück in die Innenstadt nehmen wollen. Es wäre keine aufwendige Tour geworden - vorausgesetzt, sie hätte durch eine europäische Großstadt geführt.
In Soweto dagegen rollte der Zug erst mit einer halben Stunde Verspätung aus
dem Gleis, im Gruppentaxi fehlte der Tacho, und der Bus kam überhaupt nicht.
"Meine Beamten haben die Strecke gestern abgefahren, und da fuhr noch einer",
beteuert Jacobs. Der Verkehrsminister der Gauteng-Provinz, zu der auch die
Multi-Millionen-Metropole Johannesburg gehört, lächelt amüsiert. Die kleine
Erkundungstour hat seine schlimmsten Vermutungen über den maroden Zustand des
südafrikanischen Transportsystems bestätigt. Aus gutem Grund antworten
Südafrikaner auf die Frage nach öffentlichen Verkehrsmitteln häufig mit einem
bitteren "What public transport?" Und Reiseführer raten zum Thema "Fortbewegung
in Johannesburg" nur zu zwei Dingen: Mietwagen oder - sofern kein Minibus
vorhanden - Taxi.
Und trotzdem hat Südafrika den Oktober zum Monat des öffentlichen
Personennahverkehrs ausgerufen. Dessen nicht genug: Den 20. Oktober haben die
Politiker zum autofreien Tag erklärt - dem Ersten in der Geschichte Südafrikas
und des ganzen afrikanischen Kontinents. So viele Johannesburger wie möglich
sollen Jacobs' Erfahrungen teilen - auch die, die sonst lieber in ihren
Limousinen durch die Stadt rollen. "Wenn wir etwas ändern wollen, müssen wir auf
die Verkehrsunternehmen Druck ausüben", erklärt der vor Zuversicht strahlende
Provinzpolitiker während einer Pressekonferenz. "Na toll, dann brauche ich ja
von meinem Township zur Redaktion zwei Stunden mehr", knurrt ein schwarzer
Reporter.
Angst vor Überfällen
Auf noch weniger Begeisterung dürfte der Plan bei der weißen Bevölkerung stoßen:
Wenn sie ihre mit Mauern, Stacheldraht und Elektrozäunen gesicherten Heime
einmal verlassen, dann höchstens im Wagen. Angesichts der großen Armut und den
extrem hohen Kriminalitätsraten haben sie - die durchaus begründete - Angst,
Opfer eines Überfalls zu werden. Dass sie sich am autofreien Tag zu Fuß zur
nächsten Bushaltestelle vorwagen, ist wenig wahrscheinlich.
Um einen Eindruck davon zu bekommen, wie der Personennahverkehr in
Johannesburg funktioniert, genügt es, sich morgens um acht Uhr an die Jan Smuts
Avenue zu stellen. Die Sonne, die noch schräg am Himmel steht, heizt bereits den
Asphalt der vierspurigen Fahrbahn auf, die von den hügeligen Villenvierteln im
Norden auf die graubraune Skyline von Südafrikas größter Metropole zuläuft.
Wagen drängt sich an Wagen. Johannesburgs Oberschicht macht sich auf den Weg zur
Arbeit. Meist sind es Weiße, die die modern-mondänen Geschäftsviertel wie
Sandton oder Rosebank ansteuern. Dorthin haben fast alle größeren Unternehmen in
den neunziger Jahren ihre Firmensitze verlegt: Downtown-Johannesburg war nach
dem Ende des Apartheid-Regimes zu schmuddelig und für Weiße zu gefährlich
geworden.
Vom Straßenrand drängelt sich hupend ein Toyota-Minivan zwischen die wartenden
Fahrzeuge und bringt die langsam vorwärts rollende Karawane der Berufspendler
ins Stocken. Hinter den Scheiben des Vans sind ausschließlich schwarze Gesichter
zu sehen, zwölf Personen drängen sich auf die vier Bänke, die man hinter den
Fahrersitz montiert hat. Aus einem heruntergekurbelten Fenster dröhnt
Kwaitoo-Musik, die afrikanische Mischung aus House-Music und Gangsta-Rap. Die
Autofahrer fluchen, doch sie lassen den Kleinbus einscheren: Die Beulen im
Blech, die zerknickte Stoßstange und die zerbrochenen Scheinwerfer verraten
ihnen, was demjenigen droht, der nicht den nötigen Respektsabstand wahrt.
Minibus für alle
Kaum ein anderes Verkehrsmittel ist in Johannesburg so umstritten wie das
Minibus-Taxi - und kaum ein anderes Vehikel ist derart unverzichtbar wie die
Fahrzeuge von Toyota, Nissan und VW, von denen einer amtlichen Erhebung zufolge
in Johannesburg und Umgebung rund 24.000 als Taxis fungieren. Fast alle
verkehren auf festen Routen in die Stadt hinein und wieder zurück. Wer
mitgenommen werden will, muss vom Bürgersteig aus mittels bestimmter Handzeichen
angeben, wohin er möchte. Für den Großteil der Bevölkerung stellen die Minibusse
die einzige Möglichkeit dar, um zur Arbeit zu gelangen: Gerade mal fünf Rand,
umgerechnet etwa 60 Cent, kostet eine Fahrt von Soweto, dem riesigen Township im
Südwesten Johannesburg, in die Innenstadt.
Viele der Minibus-Lenker haben nie eine Fahrschule von innen gesehen. Und
ihre Hemmungen, das Tempolimit zu überschreiten, spülen nicht wenige mit einem
ordentlichen Schluck Alkohol herunter. Wozu das führen kann, war erst in der
vergangenen Woche in allen Zeitungen nachzulesen: In der Western Cape Provinz
hatte es ein Autofahrer gewagt, einen Fahrer wegen seines rüden Fahrstils zur
Rede zu stellen. Der beleidigte Chauffeur zog kurzerhand eine Pistole, schoss
auf das Auto seines Kritikers - und traf dessen achtjährige Tochter in die
Hüfte.
Gewalt in Bahnen
Auch Busse und Bahnen haben unter Johannesburgern einen Ruf, der schlechter
nicht sein könnte - wobei Omnibusse lediglich als teuer, unpünktlich und dreckig
verrufen sind. Bahnen dagegen gelten als gefährlich: Immer wieder berichten die
Medien des Landes von Überfällen und Vergewaltigungen, die sich in den
Vorortzügen ereignen. Pannen der im Schnitt 30 Jahre alten Züge sind an der
Tagesordnung. Die entnervten Passagiere greifen mitunter zu drastischer
Vergeltung: Aus Wut über mehrstündige Verspätungen zündeten Fahrgäste in East
Rand in der Provinz Gauteng drei Züge an und verursachten einen Schaden von etwa
vier Millionen Euro.
Laut Ignatius Jacobs soll all dies nun anders werden - nicht zuletzt wegen der
anstehenden Fußball-Weltmeisterschaft, die Südafrika 2010 ausrichtet. Milliarden
Rand pumpen Land und Provinz bereits in einen Hochgeschwindigkeitszug, der
Johannesburg mit dem Regierungssitz Pretoria verbinden soll. Weitere Milliarden
sollen in neue Nahverkehrszüge, Busse, Straßen und moderne Verkehrsleitsysteme
gesteckt werden. Und auch für Bus- und Taxi-Fahrer hat sich Jacobs etwas
einfallen lassen: Serviceschulungen und Waffenverbot.
Zum Thema:
| Zum Thema in SPIEGEL ONLINE: |
|
Namibia
Der Geschichtenerzähler vom Waterberg
Lionel Moroua ist Touristenführer am Waterberg, im Naturschutzgebiet führt er Touristen zu Büffeln, Elefanten und Nashörnern. Zugleich ist er Filmer und Historiker seines Volkes, der Herero. Das geplante Kulturzentrum, von der deutschen Bundesregierung unterstützt, soll ihre Kultur bewahren helfen.
 Okakarara - Alles glüht vor Sonnenuntergang. Wenn die Abendsonne den Waterberg
im Nordosten Namibias ins Visier nimmt, leuchtet er in Farbabstufungen von
ockergelb bis violett. Wie ein Patronengürtel umkränzen steile Felsriffe das
lang gezogene Plateau, das sich aus der Dornbuschsavanne heraushebt. Das
Pastellblau des Himmels macht die Farbpalette komplett.
Okakarara - Alles glüht vor Sonnenuntergang. Wenn die Abendsonne den Waterberg
im Nordosten Namibias ins Visier nimmt, leuchtet er in Farbabstufungen von
ockergelb bis violett. Wie ein Patronengürtel umkränzen steile Felsriffe das
lang gezogene Plateau, das sich aus der Dornbuschsavanne heraushebt. Das
Pastellblau des Himmels macht die Farbpalette komplett.
Das Abendlicht leuchtet so friedlich, dass man sich kaum vorstellen kann, dass
hier vor mehr als 100 Jahren das begann, was Historiker als den ersten deutschen
Völkermord bezeichnen. Namibia war deutsche Kolonie, als es im August 1904 nach
Aufständen der Volksgruppen Herero und Nama am Waterberg zur entscheidenden
Schlacht mit den kaiserlichen Besatzungstruppen kam. Die Aufständischen wurden
geschlagen, die Überlebenden flüchteten in die nahe gelegene Omaheke-Wüste.
Zehntausende ließen dort ihr Leben.
Wo einst erbittert gekämpft wurde, tummeln sich heute Touristen, die vor allem
wegen der Tier- und Pflanzenwelt kommen. Das Besondere des tafelbergartigen
Massivs ist sein Wasserreichtum - an 15 Stellen sickert Wasser aus natürlichen
Quellen in den porösen Sandstein. So kann eine einzigartige Flora gedeihen, die
viele Tiere anzieht. Im Jahr 1972 erklärte die Regierung das Plateau zum
Naturschutzgebiet.
Giraffen, Büffel, Löwen und Nashörner
Heute ist ein besonderer Tag. "Wide und Tailor haben sich getrennt nach vielen
Jahren", flüstert Lionel. Sie hätten sich einfach nicht mehr verstanden.
"Deshalb müssen sie jetzt ihre eigenen Wege gehen", fährt Lionel fort, während
er gemeinsam mit seiner Touristengruppe die beiden Rappenantilopen-Männchen
beobachtet.
 Offiziell ist Lionel Moroua Touristenführer am Waterberg. Aber schon nach den
ersten Kilometern mit ihm im Safari-Jeep offenbart er sich darüber hinaus als
Geschichtenerzähler, Historiker, Dokumentarfilmer und Wildwart. Jahrelang seien
Wide und Tailor gemeinsam durch das Land gezogen, erzählt Lionel. Doch nun sei
es für beide Zeit, sich eine Herde mit Weibchen zu suchen.
Offiziell ist Lionel Moroua Touristenführer am Waterberg. Aber schon nach den
ersten Kilometern mit ihm im Safari-Jeep offenbart er sich darüber hinaus als
Geschichtenerzähler, Historiker, Dokumentarfilmer und Wildwart. Jahrelang seien
Wide und Tailor gemeinsam durch das Land gezogen, erzählt Lionel. Doch nun sei
es für beide Zeit, sich eine Herde mit Weibchen zu suchen.
"Insgesamt 380 Rappenantilopen haben wir hier", erklärt Lionel. Seit 17 Jahren
macht der 38-Jährige Herero diesen Job. Er weiß genau, welche Tiere die Besucher
auf seiner Pirschfahrt antreffen können: Eland, Kudu, Oryx, Damara Dik Dik, aber
auch Giraffen, Büffel, Nashörner und Löwen. 90 verschiedene Säugetierarten
kommen hier vor.
Vielen Tieren hat Lionel Namen gegeben, er sprudelt nur so die Charakteristika
heraus. Da ist etwa der Büffel mit dem Namen "4 o'clock": "Der kommt täglich um
vier Uhr zur Wasserstelle." Wide habe weit auseinander stehende Hörner, daher
sein Name, und Tailor heiße so wegen seines kurzen Schwanzes, auf Englisch tail.
Roter Sand aus der Kalahari
Genauso vielfältig wie die Tierwelt ist der Pflanzenwuchs - die Bandbreite
reicht vom buschigen Lavendelgras und Kudubusch bis hin zur Ringelhülsenakazie
und dem weit ausladenden Feigenbaum. Auch Vogelliebhaber kommen auf ihre Kosten:
Mehr als 200 Arten wurden am Waterberg entdeckt, darunter seltene Exemplare wie
der Kapgeier, der Schwalbenschwanz-Bienenfresser oder der Bergzistensänger.
 Magma habe diesen Berg vor zweieinhalb Millionen Jahren geschaffen, erzählt
Lionel. Und der rote Sand auf der Kuppe sei aus der Kalahari-Wüste im Osten
herübergeweht worden. 48 Kilometer lang ist das Plateau und 8 bis 16 Kilometer
breit. Es liegt an seiner höchsten Stelle 1800 Meter über dem Meeresspiegel. Von
seinem Rand aus kann man in die Weite der Omaheke-Wüste blicken.
Magma habe diesen Berg vor zweieinhalb Millionen Jahren geschaffen, erzählt
Lionel. Und der rote Sand auf der Kuppe sei aus der Kalahari-Wüste im Osten
herübergeweht worden. 48 Kilometer lang ist das Plateau und 8 bis 16 Kilometer
breit. Es liegt an seiner höchsten Stelle 1800 Meter über dem Meeresspiegel. Von
seinem Rand aus kann man in die Weite der Omaheke-Wüste blicken.
Der Krieg von 1904 und die Vertreibung in die Wüste sind weiterhin
beherrschendes Thema bei den Herero Namibias. "Wir sprechen zu Hause jeden Tag
darüber", sagt Lionel. Sein Großonkel Tjejo etwa habe während der Schlacht einen
Kanonenwagen gestoppt. Allerdings hegt Lionel keinen Groll gegen die ehemaligen
Kolonialherren: "Für mich sind die Deutschen Schwestern und Brüder." Ein
Soldatenfriedhof am Fuß des Waterbergs erinnert an die gefallenen Deutschen.
Entschuldigung durch Wieczorek-Zeul
Vertreter der Herero hatten 2001 die Anerkennung des Völkermordes durch den
Deutschen Bundestag sowie Wiedergutmachung gefordert. Im August 2004 kam es in
Okakarara zur historischen Entschuldigung: In dem 60 Kilometer östlich vom
Waterberg gelegenen Ort entschuldigte sich Entwicklungshilfeministerin
Heidemarie Wieczorek-Zeul für die Verbrechen der deutschen Kolonialherren. Nun
entsteht hier ein kleines Kulturzentrum mit einem Museum, einer Freiluftbühne
und einem Denkmal - auch die Bundesregierung unterstützt das Projekt.
 Der Ort Okakarara selbst ist unauffällig. Es gibt eine Hauptstraße, zwei
Supermärkte, etliche Bottle-Stores und Bars. "Hier herrscht fast 80 Prozent
Arbeitslosigkeit", sagt Almut Hielscher, die Koordinatorin des Zentrums. Es soll
Touristen anziehen, Arbeitsplätze schaffen und die Gegend insgesamt attraktiver
machen. "Außerdem soll es Kultur und Geschichte der Herero wahren."
Der Ort Okakarara selbst ist unauffällig. Es gibt eine Hauptstraße, zwei
Supermärkte, etliche Bottle-Stores und Bars. "Hier herrscht fast 80 Prozent
Arbeitslosigkeit", sagt Almut Hielscher, die Koordinatorin des Zentrums. Es soll
Touristen anziehen, Arbeitsplätze schaffen und die Gegend insgesamt attraktiver
machen. "Außerdem soll es Kultur und Geschichte der Herero wahren."
Lionel begrüßt das Projekt: "Das Zentrum wird mehr Entwicklung nach Okakarara
bringen." Gemeinsam mit Freunden will er außerdem einen Film drehen über die
Zeit vor, während und nach der Schlacht. Seine oberen vier Schneidezähne hat er
entfernen lassen - ein Schönheitssymbol seiner Herero-Kultur. Außerdem will er
zurück zu traditioneller Kleidung, Leopardenhaut tragen und Ochsenwagen fahren.
Für Besucher möchte er traditionelle Herero-Hütten bauen: "Damit will ich meine
Geschichte zurückbringen."
Von Christiane Schulte, gms
SPIEGEL
ONLINE - 01. Februar 2005, 15:19
URL: http://www.spiegel.de/reise/fernweh/0,1518,339682,00.html
Zum Thema:
| Zum Thema in SPIEGEL ONLINE: |
|
Südafrika
Aus Johannesburg berichtet Roman Heflik
Jahrelang galten Einkaufszentren als letzter Rückzugsort für wohlhabende Südafrikaner. Nirgendwo sonst war man sicherer vor Schießereien, Entführungen und Vergewaltigungen. Doch jetzt geraten auch die Konsumtempel ins Visier militärisch organisierter Banden.
Johannesburg - Manchmal, nach der Arbeit, will Thamsanqa noch links ranfahren und ein paar Zigaretten für seinen Bruder kaufen. Die könnten Thamsanqa und Anele dann in ihrer gemeinsamen Bude rauchen, dazu 2Pac hören und ein Bier trinken. Aber dieser Gedanke verfliegt inzwischen immer schneller. Schließlich ist es schon zwei Monate her, dass Anele bei dem Überfall erschossen wurde.
 |
|
Netcare 911
Polizisten vor einem überfallenen
Geldtransporter in Johannesburg: "Hochgradig organisiert"
|

 Themba Godi: COMMENT 14
December 2005 04:00
http://www.mg.co.za/articlePage.aspx?articleid=259192&area=/insight/insight__comment_and_analysis/#
Themba Godi: COMMENT 14
December 2005 04:00
http://www.mg.co.za/articlePage.aspx?articleid=259192&area=/insight/insight__comment_and_analysis/#
 When President Thabo Mbeki
took to the parliamentary podium in 1996 and declared “I am an African,”
everyone in Parliament who spoke during that debate declared and asserted that
they were Africans, from African National Congress members to those of the
Freedom Front.
When President Thabo Mbeki
took to the parliamentary podium in 1996 and declared “I am an African,”
everyone in Parliament who spoke during that debate declared and asserted that
they were Africans, from African National Congress members to those of the
Freedom Front.
The ruling party has since undergone a Damascene conversion. Overnight,
everyone, from the Cabinet to the rank and file, rediscovered their indigenous
names and forswore the European names by which they had been known throughout
their struggle years.
To the average Pan Africanist Congress cadre this was strange. We had always
said that if a frog went to other frogs and declared that it was a frog, the
response would be: “so what?” because it was a given.
But not so for some Africans in Azania. So deep was the extent of colonial
de-education that the bonds of a pan-African nationhood were frayed.
Though the truth of an encompassing Africanness was always self-evident for us,
some issues are still worth exploring as we consider the presence and future of
“white” Africans.
We have seen how some people from the “white” community who are overtly
right-wing and racist in practice -- such as those who drag Africans to death
behind their bakkies, feed them to carnivores, engage in feudal relations of
production or heartlessly refuse people the burial of their deceased -- with a
straight face declare that they are Africans.
To their continuous frustration they find rejection; they find a yawning gulf
between them and their supposed kinsmen (the indigenous Africans). This has led
to some endlessly writing and bemoaning the fact that, despite their repeated
declarations of Africanness, they don’t seem to find acceptance from their
supposed kinsmen (the indigenous).
This has led some to ask whether they can ever be, or be accepted as, Africans;
while many blacks ask whether these people are really Africans?
The question has never arisen about who or what is a Chinese, an Arab or an
Italian and so it should not about Africans.
But it arises because in the past our own right to exist, our humanity and equal
share in the common brotherhood and sisterhood of humankind have been
questioned.
The question that arises, therefore, is how non-indigenous citizens can become
Africans and whether one can be accepted as such? The basic principles of the
PAC say that this is possible and necessary for our country, Azania, and the
continent.
The PAC, from its inception, has refused to identify people in terms of colour.
In the 1990s the PAC had a T-Shirt which read: “Call me African, not black,
white, coloured or Indian!”
This reflected the principles of the PAC on building a single African
nationhood, rather than the notion of rainbowism with its inherent assumptions
of eternal separateness and differences. The so-called “whites” and “Indians”
who joined the PAC realised their full humanity and felt the genuine bonds of
comradeship and Africanism.
An African refers to the indigenous citizens (first and foremost) and to anybody
who accepts the democratic rule of the African majority; owes his or her loyalty
to Africa and works for its development.
It cannot be a nationality in flux. There are many in the “white” community who
say they are Africans when they want to protect their (material) interests, but
when things are normal they disparage everything African and never stop
lecturing us about the etiquette of Western Europe.
In my view, the dominant norms and values that should anchor society must be
African. So anybody declaring himself or herself to be an African without
respecting and identifying with the fundamental and progressive values that give
us our African identity will continue to wallow in the waters of rejection.
The “white” soccer players who played for Pirates, Chiefs or Swallows are
accepted fully, have African nicknames and, I suppose, have never felt alone or
isolated in a jam-packed Orlando Stadium.
Or take the example of Johnny Clegg. His musical idiom was African -- he
played, sang and danced like any African. He definitely did not feel like an
island in a sea of hostel dwellers, but he was also accepted as one of the
masses.
Thus anyone becoming an African cannot be a minority; for you identify and
become a part or one with the majority. You became the majority.
So it is possible and desirable that everyone in Africa should become an
African, identify with Africa, work for its development, and respect and embrace
its values and norms.
Robert Sobukwe declared, back in 1959: “There is only one race to which we all
belong -- the human race. Here is a tree, rooted in African soil, watered with
water from the rivers of Africa. Come sit under its shade and become with us
leaves of the same branch, and branches of the same tree.”
Themba Godi is the deputy president of the Pan Africanist Congress and the
chairperson of Parliament’s standing committee on public accounts
Owners of the oft-moved Weber House aren't hurrying as they restore the 19th century home
December 20, 2005 http://www.thevictoriaadvocate.com/local/local/story/3228464p-3737277c.html.....
Hopkins said, "Johnny Clegg was fixing to move it. I took one look and said, 'I'll take it.' I went on record that if they back out you can move it to my house."
....
Kino in Südafrika
Von Rüdiger Sturm
Nach Asien und Südamerika entwickelt sich Südafrika zum neuen Kino-Trendregion. Festivalerfolge wie "U-Carmen" und "Tsotsi" verblüffen Publikum und Kritiker.
Auch Filmjournalisten lieben ihren Schlaf. Als bei der diesjährigen Berlinale am frühen Sonntagmorgen ein Film mit dem exotischen Titel "U-Carmen eKhayelitsha" lief, war die Pressevorführung gähnend leer. Vielleicht lag es an der legendären Party einer dänischen Filmfirma, die am Vorabend stattgefunden hatte, vielleicht war aber auch das Konzept des Films zu bizarr: eine Version von George Bizets Opernhit, übertragen auf einen südafrikanischen Township, dargeboten von nichtprofessionellen Sängern im Einheimischen-Dialekt Xhosa.
Dass das Gros der Filmpresse damit eine kleine Sensation verschlafen hatte,
wurde spätestens bei der Preisverleihung klar. "U-Carmen" erhielt den Goldenen
Bären als Bester Film und stach damit die Hollywood-Konkurrenz ebenso wie den
deutschen Favoriten "Sophie Scholl" aus.
Doch der Triumph von "U-Carmen", der seit diesem Donnerstag in den deutschen
Kinos läuft, ist kein Zufallstreffer. In Südafrika formiert sich eine Filmszene,
die mit ihrer Vitalität zunehmend für Furore im Weltkino sorgt. Während der
Ethno-Bizet mit seiner drallen Hauptdarstellerin Pauline Malefane Berlin
eroberte, war parallel ein anderer Film vom Kap für den Auslands-Oscar nominiert
- "Yesterday", ein ebenso unsentimentales wie poetisches Drama über eine
Aids-kranke Mutter.
Wenige Monate später gelang dem südafrikanischen Kino der nächste Coup:
"Tsotsi", die Geschichte über einen skrupellosen Gangster, der sich des Babys
seines Mordopfers annimmt, gewann beim renommierten Filmfestival von Toronto den
Publikumspreis - wie seinerzeit "Tiger & Dragon" oder "American Beauty". Die
pulsierende Intensität des Krimidramas erinnerte manche Kritiker an das
südamerikanische Favela-Drama "City of God". Um die internationalen Rechte
rissen sich Verleihgrößen wie Miramax oder Kinowelt. Inzwischen wurde das Drama
als südafrikanischer Beitrag für den Auslands-Oscar eingereicht und erhielt eine
Nominierung als bester fremdsprachiger Film bei den Golden Globes.
Know-how aus dem Ausland
Die Kaprepublik ist in der Branche keine unbekannte Größe. Vom TV-Movie mit
Veronica Ferres bis zum neuesten Leonardo-DiCaprio-Film "The Blood Diamond" -
von der internationalen Filmindustrie wird sie längst als Drehort genutzt.
Südafrikanische Schenkelklopf-Komödien wie "Mr. Bones" schaffen es auch auf
internationale Leinwände. Die jüngsten Festival-Erfolge haben jedoch eine ganz
andere Qualität. Sie sind in den Landessprachen gedreht und reflektieren die
soziale Realität des Post-Apartheid-Staates.
"U-Carmen"-Regisseur Mark Dornford-May und seine Mitarbeiter adaptierten ihr
Opernlibretto detailliert auf die Verhältnisse des Townships Khayelitsha.
"Tsotsi"-Regisseur Gavin Hood besetzte Amateurschauspieler aus den
Elendsvierteln, um seinem Szenario die nötige Authentizität zu verleihen: "Es
ist so selten, dass wir unser Leben auf der Leinwand wiederfinden", sagt er im
Interview. Der unlängst fertig gestellte neue Film der "U-Carmen"-Truppe, "Son
of Man", erzählt eine moderne Jesus-Geschichte in den Townships.
Die Akteure der jungen Kinoindustrie haben sich ihr Know-how zumeist im Ausland
erworben. Gavin Hood studierte Film an der University of California in Los
Angeles, einer der wichtigsten Talentschmieden Hollywoods. Sein Kollege Zola
Maseko, dessen Apartheid-Drama "Drum" im Herbst in Deutschland startete, eignete
sich das technische Rüstzeug an einer englischen Filmhochschule an.
"U-Carmen"-Produzent Ross Garland wiederum blickt auf eine Karriere als
Investmentbanker in New York zurück.
Subventionen für die Filmemacher
Gleichzeitig wird der Mini-Boom von Nicht-Südafrikanern gefördert. "Bei uns gibt
es noch nicht genügend Produzenten für ambitionierte Projekte", meint Zola
Maseko. Sein auf Englisch gedrehter Film "Drum" kam erst zustande, als
ausländische Finanziers einsprangen. Vertriebsfirmen wie die ursprünglich auf
asiatische Filme spezialisierte Fortissimo, die auch bei "U-Carmen" einstieg,
engagieren sich zunehmend in der Region. Zur Unterstützung lokaler Talente gibt
es Initiativen wie einen Schreibwettbewerb des U.K. Film Council, mit dem
Produzenten für südafrikanische Drehbuchautoren gefunden werden sollen.
Letztlich entscheidend ist aber auch die politische Rückendeckung für die jungen
Filmemacher. Finanzminister Trevor Manual schmückte seine Rede bei der
diesjährigen Etat-Debatte mit etlichen Verweisen auf den Erfolg von "U-Carmen".
Kulturminister Pallo Jordan wiederum will mit seinen Subventionen gezielt
Produktionen in den Landessprachen fördern: "Wir müssen das Wachstum in diesem
Sektor noch beschleunigen." Für das nächste Jahr kündigte er ein
panafrikanisches Gipfeltreffen von Filmemachern an - auch um Wege zu finden, wie
sich die Erfolge von "U-Carmen" und "Yesterday" fortsetzen lassen. Schon jetzt
bekommen lokale Kinoproduktionen 25 Prozent des Budgets, das sie in Südafrika
ausgeben, aus der Staatskasse erstattet.
Aber ist das heimische Publikum überhaupt an solchen Filmen interessiert? Der
Kinomarkt in Südafrika wird beherrscht von Ware aus Hollywood, die weitgehend in
den mondänen Multiplexen der Weißenviertel läuft. Der größte südafrikanische Hit
dieses Jahres ist die neue Klamotte von "Mr. Bones"-Macher Leon Schuster, "Mama
Jack" - über einen Weißen, der sich auf der Flucht vor der Polizei als schwarze
Frau maskiert. Der größte Teil des 40-Millionen-Volks war indes noch nie im Kino
- eine Folge der Apartheid, aber auch eine Folge von Sprachbarrieren und hohen
Ticketpreisen. Vorführungen finden bestenfalls in öffentlichen Sälen oder auf
Pick-up-Trucks statt.
Doch auch das soll sich jetzt ändern. Die Organisation "Shout Africa" ist gerade
dabei, in den Townships und ärmeren Landesteilen Kinos mit digitaler Projektion
zu installieren. Hier sollen neben internationalen Filmen auch die heimischen
Produktionen laufen - mit Untertiteln für die jeweilige Region - alles zu
niedrigen Preisen. Falls dieser Versuch fehlschlägt, könnte sich die neue
Generation der Filmemacher immer noch auf die internationalen Zuschauer
verlassen. Doch dieses Denken scheint den Betroffenen fremd. "Tsotsi"-Regisseur
Hoods hat seine Prioritäten klar gesteckt: "Das Wichtigste ist es, dass das
südafrikanische Publikum meine Filme sieht und mag."
Zum Thema:
| Zum Thema in SPIEGEL ONLINE: |
|
Namibia
Die natürliche Heimat eines Quad ist die Wildnis. Und welche Landschaft könnte wilder und lebensfeindlicher sein als die älteste Wüste der Welt: die Namib. Mit einem vierrädrigen Offroader drang Antje Blinda zu versteinerten Menschenspuren, Totenschädeln und Nebeltrinkern vor.
"Angst? Nein, Angst habe ich nicht." Aber seltsamerweise habe ich gerade gar keine Lust, mich mit diesem vierrädrigen Monster eine 15 Meter hohe Düne runterzustürzen, im richtigen Moment aufzuspringen, damit das Quad und ich die nächste Düne wieder hinaufschießen und gemeinsam über den Kamm springen können - und das alles, ohne jemals weniger als Vollgas zu geben, wie Fanie, unser 56-jähriger Wüsten- und Quad-Führer, uns eindringlich erklärt hat.
WÜSTE NAMIB: QUADS,!NARAS, TOTENSCHÄDEL
 |
 |
 |
Klicken Sie auf ein Bild, um die Fotostrecke zu starten (6 Bilder).
Versteinerte Spuren von Mensch und Giraffe
Dabei sind die bis zu 55 km/h schnellen, vollautomatischen Vierräder auf unserer Tour eigentlich nur Mittel zum Zweck, ansonsten würde man nur mit Kamelen oder Pferden zu den Geheimnissen der ältesten Wüste der Welt vorstoßen können. Im Gegensatz zu anderen Veranstaltern, die reinen Fahrspaß auf vorgegebenen Routen anbieten, hat Fanie als Einziger die Erlaubnis, mit Quads tiefer in die Namib einzudringen und den Gästen seine Entdeckungen zu zeigen: die Fußspuren von Nashorn, Giraffe, Oryx und Mensch, die diese vor Tausenden von Jahren im Lehm des Kuiseb hinterlassen haben.
Damals hat der Fluss, der heute auf seinem Weg zum Atlantik schon weit vorher im Wüstensand versickert, viel Wasser geführt. Deutlich sehen wir im erhärteten Lehm, wie sich Elefanten-, Büffel- und Menschenspuren kreuzen - oder fast kreuzen, denn plötzlich gibt es keine menschlichen Fußabdrücke mehr. Ist der Mann oder die Frau auf den Büffel gestiegen oder auf den Elefanten, oder gab es ein dramatisches Ende? Dieses Geheimnis ist eines der vielen, die die Namib für sich behält. Die zierlichen Vogelspuren gleich daneben lösen das Rätsel leider auch nicht.
Einige Kilometer weiter erstrecken sich vor uns die gelben, sichelförmigen Dünen scheinbar endlos bis zum Horizont. Wie Klippen am Küstenrand ragen sie steil in den Himmel, ihr Grat ist messerscharf, und wie das Wasser am Meeresboden formt der Wind die wellenartigen Strukturen auf ihren Rücken. Wie ein großes Kunstwerk, wie exakt geformte Skulpturen - nur sind sie nie vollendet, der scharfe Wind vom nur wenige Kilometer entfernten Atlantik lässt sie immer weiterwandern, ihre Form verändern und sich neu erschaffen.
Wenn das Röhren der Quads nicht gerade unsere Ohren füllt, ist in der Ton- und Leblosigkeit der Weite nur Sand zu hören: Er rieselt, raschelt, quietscht beim Gehen - und brüllt. Theoretisch. Rutschen die Körner die Innenwand einer Düne herunter, erzeugen sie Druck- und damit Schallwellen und somit Töne, die sich zu einem wahren Brummkonzert summieren können, die noch 15 Kilometer weit zu hören sind. Leider brüllt uns heute keine Düne an, dafür winkt Fanie.
Gräberfeld zwischen Dünen
Mittlerweile erhitzt von der steigenden Sonne, aber schon recht cool im Umgang mit unseren Stahlrössern, schwingen wir uns wieder auf die Quads, schnallen den Helm fest, sichern die Kamera, nehmen einen letzten Schluck aus der Wasserflasche und fegen Fanie hinterher. "Ihr müsst mit dem Arsch lenken!" und "Ihr müsst mir immer genau folgen", hat Fanie uns zu Beginn in seinem charmanten Niederländisch-Deutsch-Englisch angewiesen. Was es heißt, neben der Spur zu liegen, muss Ralf erfahren: Gnadenlos versackt das Quad im Sand, nur zu viert können wir es mit Mühe ausgraben. Fanie rast haarscharf am Abgrund vorbei, gibt Gas bei seichteren Abfahrten und schwingt sich dröhnend in die Höhe, legt sich in eine Linkskurve - und in einer nächsten Fahrlektion lernen wir die steilen Dünenhänge mit angezogener Bremse einfach herunterzurutschen.
 |
|
DER SPIEGEL
Namibia: Walvis Bay (oder auch Walfischbai
genannt) liegt zwischen Atlantik und Namib
|
Nebeltrinker und !Nara-Melone
Doch nicht umsonst heißt die Fahrt "Historic and Living Desert Quad Tour" - die Wüste lebt doch. Im Gegensatz zu der erdgeschichtlich sehr viel jüngeren Sahara hat die Namib Tieren und Pflanzen viel Zeit zur Anpassung gegeben. Fanie zeigt uns die !Nara-Melone und wie sie mit bis zu 40 Meter langen Wurzeln wunderbarerweise Hitze und Trockenheit überdauert. Daneben huscht der schwarze Nebeltrinker auf seinen langen Beinen über den Sand, ein Käfer, der am frühen Morgen mit erhobenem Hinterteil den Nebeltropfen in der kühlen Wüste auffängt. Fanie bricht für uns eine Frucht einer Sirub auf und lässt uns probieren: irgendwie nicht lecker, aber nahrhaft für Wüstenbewohner.
Die Sonne steht im Zenit und brutzelt auf unsere Helme. In den langärmeligen Shirts und langen Hosen wird es bei über 40 Grad unerträglich heiß - Zeit für einen Zwischensprint mit dem Quad. Längst habe ich die Orientierung verloren, irgendwo muss das Meer sein mit seinem kalten Benguela-Strom, und irgendwo Swakopmund, der letzte Rest eines deutschen Kolonialposten, mit seinem geringelten Leuchtturm und den Häusern und Villen aus Kaisers Zeiten. Plötzlich kreuzt ein Mann unseren Weg, in langer, dunkler Anzughose, mit Flip-Flops und einer kleinen Wasserflasche - er ist auf dem Weg zu seiner Familie in der Wüste, übersetzt Fanie für uns.
Ins Quad-Business ist Fanie erst vor einigen Jahren eingestiegen, nachdem er sich von seinem früheren Leben als Geschäftsführer in Südafrika verabschiedet hatte. Sein Wissen über Geschichte, Traditionen und Natur der Wüste scheint unerschöpflich. Seine Anekdoten reißen nicht ab, und erst nach über vier Stunden sind wir zurück in Walvis Bay am Atlantik, nach einmaligen Lehrstunden über ein nur scheinbar lebensfeindliches Ökosystem - und nach unzähligen Hüpfern über Dünenkämme.
Zum Thema:
QUAD-TOUR IN DER NAMIB
Fanie du Preez bietet mit seinem Unternehmen
Kuiseb Delta Adventures
in Walvis Bay auf Anmeldung Wüstentouren stunden- ,
aber auch tageweise an. Seine historischen Touren "Historian and Living Desert
Quad Tours" dauern drei oder vier Stunden und kosten 500 Namibia-
Dollar (circa 65 Euro) oder 550 Namibia- Dollar(circa 72 Euro).
E- Mail: fanie@kuisebonline.com
| Zum Thema in SPIEGEL ONLINE: |
|
UniSPIEGEL 2/2006 - 18. Mai 2006
URL: http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/0,1518,410715,00.html
Studium in Johannesburg
Von Roman Heflik
Carolin Sobiech und Peter Falk studieren in Johannesburg, der gefährlichsten Stadt Südafrikas. Campus und Wohnheim sind bewacht wie ein Hochsicherheitstrakt. Doch die deutschen Studenten erobern sich ihre Freiheiten - und schätzen den Kontakt mit der harten Realität.
Morgens gegen neun beginnt für die Soziologiestudentin Carolin Sobiech der Weg durch den Dschungel. Sie geht am Notrufschalter für den Wachdienst vorbei, sperrt die Haustür auf, tippt den vierstelligen Code in die Alarmanlage und wartet, bis das rote Licht am Bewegungsmelder ausgeht. Bevor sie die Gittertür in der zwei Meter hohen, von Stahldornen gekrönten Mauer öffnet, stellt die 25-Jährige ihr Handy auf lautlos, damit niemand merken kann, dass sie eines bei sich trägt. Sie winkt sich ein klappriges Minibus-Taxi heran, in das sich schon Dutzende Leute hineingequetscht haben. Das Handy stellt sie erst wieder um, als sie am Ziel ihrer Fahrt angekommen ist - dem Eingang zur Johannesburger Witwatersrand University.
Unter den Blicken der Sicherheitsbeamten zieht Carolin ihre Karte durch ein Lesegerät und passiert die gläserne Sicherheitsschleuse, die den "Wits"-Campus vom Rest der Dreieinhalb-Millionen-Metropole Johannesburg abschottet. "Daran muss man sich erst mal gewöhnen", sagt die junge Frau aus Hannover und lächelt entschuldigend. Es geht einen verwinkelten Korridor entlang und zwischen mächtigen griechischen Säulen hindurch. Plötzlich gleißt grelles Sonnenlicht. Zu Füßen einer Freitreppe öffnet sich ein Forum, umgeben von alten, wuchtigen Uni-Gebäuden. Hinter dem Platz liegt eine makellose Rasenfläche, an deren Rändern die fliederfarbenen Blüten der Jacaranda-Bäume leuchten. In der Ferne schimmert das Blau des Universitätsschwimmbeckens.
Tatsächlich, das Studieren in Johannesburg ist gewöhnungsbedürftig. Es gleicht dem Leben in einer Burg: Rund um den idyllischen Campus der Witwatersrand University zieht sich ein massiver Stahlzaun, vor den Toren stehen Wächter, an vielen Gebäuden sind Überwachungskameras installiert. Das Wohnheim der Universität im nahegelegenen Stadtteil Braamfontein darf nur betreten, wessen Fingerabdruck vom Scanner am Haupteingang akzeptiert wurde.
Seit Jahrzehnten ist die ehemalige Goldgräberstadt für eine der höchsten Kriminalitätsraten weltweit berüchtigt: Für die Zeit von April 2004 bis März 2005 erfasst die Statistik für die Gauteng-Provinz, in der Johannesburg liegt, 3611 Morde, 11 923 Vergewaltigungen und 55.139 schwere Raube. Zum Vergleich: 2004 wurden für die gesamte Bundesrepublik, die etwa zehnmal so viele Einwohner wie Gauteng zählt, 2480 Fälle von Mord und Totschlag einschließlich Versuche registriert. Und trotzdem kommen immer wieder deutsche Studenten nach "Joburg".
Keine Gefahrensucher
Nein, eine Gefahrensucherin sei sie nicht, sagt Carolin Sobiech. Schließlich respektiere sie fast alle der üblichen Vorsichtsregeln. "Aber wenn man sich in Johannesburg ständig Gedanken machen würde, dürfte man gar nicht mehr auf die Straße gehen." Dennoch habe die Stadt sie allmählich verändert, erzählt die junge Frau: "Man fängt automatisch an, die Leute auf der Straße abzuchecken: Sieht der da aus wie ein 'mugger', ein Straßenräuber? Oder trägt er eine Einkaufstüte und ist vielleicht bloß auf dem Weg nach Hause?" Das sei in den ersten Wochen anstrengend gewesen. Wie eingesperrt habe sie sich gefühlt. Doch dann setzte sich bei ihr der Entdeckerdrang durch. Heute ist sie sicher, dass ein Studium in Johannesburg alle Ängste der ersten Wochen wert ist.
Wer hier sein Studium aufnimmt, merkt schnell: Das eigentliche Lernen findet nicht im Seminarraum statt. Wie im Fall von Peter Falk, der in Köln BWL studierte und nun an der renommierten Wits Business School seinen Master of Business Administration macht. Fast 10.000 Kommilitonen hatte Peter an seiner Fakultät in Köln, doch keiner von ihnen wollte mit ihm nach Johannesburg kommen. Von Freunden und Verwandten hagelte es Warnungen. "Meine Mutter hat mich nur gefragt: 'Junge, willst du nicht lieber nach Finnland?'" Der Blondschopf grinst. Er ist froh, dass er bei seinem Entschluss geblieben ist. Denn sein Aufenthalt in Johannesburg ist mehr als eines dieser studentischen Auslandsjahre, die sich später nett im Lebenslauf machen. Für Peter ist die Zeit in "Joburg" in erster Linie ein großes Abenteuer.
"Ich war am Anfang schon sehr von all den Geschichten über die Stadt eingeschüchtert", berichtet der 24-Jährige, der hier seit Juni lebt. "Hinter jeder Ecke habe ich Räuber gesehen, und den Taxifahrern am Flughafen habe ich auch nicht getraut." Aufgeatmet habe er erst wieder, als er in seinem Wohnheim im Stadtteil Parktown ankam: Ringsum Zäune, Wächter, Schranken - alles, um ihn vor der wilden Stadt da draußen zu beschützen.
Doch Peters freiwilliges Leben im Käfig dauerte nur ein paar Stunden. Noch am ersten Abend nahm ihn ein einheimischer Kommilitone auf ein Bier mit nach Hillbrow. Das einst noble Amüsierviertel gilt heute als absolute "No go"-Zone, die fest in der Hand von nigerianischen Banden ist. Reiseführer warnen vor einem Besuch der Gegend, in die sich sogar die Polizei nicht gern hineinwagt. Peter fuhr trotzdem mit. "Es war gar nicht so schlimm", erinnert er sich. "Hillbrow hat Flair, auch wenn an der Ecke etwa zehn Drogendealer herumstanden, während wir unser Bier getrunken haben." Peter hatte die erste Scheu vor Südafrika verloren.
Harte soziale Realität
Auch mit seinem Studium arrangierte er sich schnell. Zwar ist die Wits Business School eine der angesehensten Wirtschaftsfakultäten ganz Afrikas, doch sei dieser Anspruch etwas übertrieben, findet Peter. "Das Studium hier ist zwar arbeitsintensiv, aber irgendwann merkte ich, dass man die Hausarbeiten notfalls auch runterschmieren kann und immer noch ganz gute Noten bekommt." So sei die Freizeit nie zu kurz gekommen. Lohnend sei vor allem das Unterrichtsangebot, zu dem auch spezielle Seminare wie "Storytelling in Unternehmen", Verhandlungsführung oder "Interkulturelles Management" gehören. "Und mit deutschem Uni-Wissen kommt man absolut zurecht", versichert Peter.
Carolin Sobiech kennt Hillbrow ebenfalls, sie hat sogar dort gearbeitet: Für eine Nichtregierungsorganisation kümmerte sie sich vier Monate lang um die Reintegration von Prostituierten. "Erschreckend" sei die Arbeit manchmal gewesen, sagt sie, "aber genau so etwas wollte ich machen. Nur im Hörsaal sitzen, das kann ich auch in Deutschland." Und noch ein Punkt sprach aus ihrer Sicht für Johannesburg: die Wissenschaft. Denn als Forschungsschwerpunkt hat sie sich das Thema Aids im soziologischen und historischen Kontext ausgesucht. Experten schätzen, dass in der Region um Johannesburg etwa jeder Dritte mit dem HI-Virus infiziert ist.
Kaum jemand kann sich den gesellschaftlichen Problemen und Kontrasten Südafrikas entziehen. Carolin kann sich noch gut an eine Exkursion erinnern, die sie in eine Geburtsklinik im Armenviertel Alexandra führte. "Das war unglaublich." Geburtsvorbereitungskurse habe es keine gegeben, Ärzte schon gar nicht. "Und nach der Geburt haben die Frauen vier Stunden Zeit, dann müssen sie nach Hause gehen." Auf dem Heimweg sei ihre Gruppe dann durch das benachbarte Sandton gefahren, erzählt sie und schüttelt den Kopf. Der Stadtteil im Norden gilt als wohlhabendste Gemeinde in ganz Afrika. Nur die Superreichen können sich die vornehmen Anwesen leisten, die sich hinter hohen Mauern verbergen. Nirgendwo scheint die Dichte an Mercedes- und BMW-Limousinen höher zu sein als in Sandton. In Alexandra nebenan können die meisten kaum den Bus bezahlen.
Ein Land, viele verschiedene Welten - so mancher deutsche Student gewöhnt sich hier nur langsam an die Unterschiede zwischen Arm und Reich, zwischen Schwarz und Weiß. Und an das Gefühl, plötzlich wegen seiner Hautfarbe zu einer reichen Minderheit gezählt zu werden.
Mehr als zehn Jahre nach dem Ende der Apartheid bestehen noch immer Vorbehalte, auch auf dem Campus. Rassismus hätten sie zwar nicht erlebt, sagen Carolin und Peter, aber eine Art Berührungsangst gebe es auf beiden Seiten schon. "Wer in Kontakt mit Afrikanern kommen will, der kann das auch", versichert Peter - wenn man bereit sei, sich auf fremde Sitten einzulassen. Dazu könne gehören, dass man sich nicht scheue, als einziger Weißer auf der Party eines schwarzen Bekannten aufzutauchen oder das Nationalgericht "steak and pap" auch mal mit den Händen zu essen.
Diese Strategie führte Peter sogar bis nach Soweto. Normalerweise meiden Weiße die riesige Township vor den Toren Johannesburgs. Der Kölner dagegen wurde auf eine Party dorthin mitgenommen. Auch eine Schlafgelegenheit organisierten seine Gastgeber für den exotischen Gast. "Da habe ich dann in einer dieser typischen Wellblechhütten genächtigt", erinnert er sich. Etwas frierend, dafür aber um eine Erfahrung reicher sei er am nächsten Morgen aufgewacht. Wenn man ihn heute fragt, was ihn an Südafrika und Johannesburg am meisten beeindruckt, antwortet der Deutsche ohne Zögern: "die Gastfreundschaft und die Lebensfreude der Menschen".
Zum Thema:
| Zum Thema in SPIEGEL ONLINE: |
http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/0,1518,400557,00.html http://www.spiegel.de/unispiegel/schule/0,1518,395078,00.html http://www.spiegel.de/unispiegel/schule/0,1518,365796,00.html http://www.spiegel.de/unispiegel/wunderbar/0,1518,329571,00.html |
|
| Zum Thema im Internet: |
SPIEGEL ONLINE - 29. Juni 2006, 07:07
URL: http://www.spiegel.de/reise/fernweh/0,1518,424158,00.html
Reiten in Südafrika
Das Nashorn lässt den Reiter dicht heran, die Giraffe wagt einen gemeinsamen Galopp: Zu Pferd ist die Begegnung mit Natur und Kultur Südafrikas besonders intensiv. Reitsafaris führen durch Busch, Weinberge und entlang von Stränden.
Kapstadt/Pongola - Die Morgensonne strahlt, die Luft ist klar. Das Landgut "Palmiet Valley" am Fuße der Drakenstein-Berge, etwa eine halbe Stunde von Kapstadt entfernt, erwacht. In den Weinbergen und Obstplantagen wird schon gearbeitet. Ein Mercedes-Oldtimer rollt durch den Park des restaurierten Herrenhauses, erbaut 1717 von Holländern in dem für die Kapregion typischen "Cape Dutch", dem kapholländischen Baustil. Der Gast in Reitkleidung versinkt tief im Fond der Limousine, Baujahr 1958. Am Steuer sitzt der deutsche Hausherr selbst, Fred Uhlendorf.
Uhlendorf fährt seine Gäste zu ausgewählten Reitställen der Umgebung - eine überaus stilvolle Anfahrt für einen Ausritt in die Winelands. Diesmal geht es zum Reitstall "Paradise Stable" bei Franschhoek, neben Stellenbosch und Paarl eines der bekannten Weinanbaugebiete der Gegend. "Wir reiten heute zum Weingut "Mont Rochelle"", erklärt der Besitzer Pieter Hugo. Dafür werden einige seiner 25 Araber gesattelt. "Wir züchten unsere Pferde selbst", erklärt der 55-Jährige.
Auf der Tour durch die Weinberge geht es vorwiegend im Schritt. "Die Leute können so die Landschaft genießen, und auch schwächere Reiter fühlen sich sicher", erzählt Pieter. Nach etwa einer Stunde ist das Weingut erreicht. Während die Pferde angebunden warten, kosten die Reiter verschiedene Weine. "Mont Rochelle" ist eines der wenigen Weingüter mit einem farbigen Besitzer und einer Frau als Winzerin. Leicht beschwingt geht es auf dem Pferderücken zurück zum Stall.
Mehrtägige Trails mit Weinverkostung
Am Tag darauf steht ein Besuch bei Michelle Mazurkiewicz auf dem Programm. Die 35-Jährige ist eine echte Pferdefachfrau. Auf ihrem Hof bei Rhebokskloof können Urlauber Ausritte in die Umgebung machen. "Wir unternehmen aber auch mehrtägige Trails mit Übernachtungen auf Weingütern - natürlich mit Weindegustation", erzählt Michelle. Bereits vor vielen Jahren gründete sie ihre Firma "Wine Valley Horse Trails", inzwischen besitzt sie mehr als 180 Pferde, die sie auch für Filmaufnahmen zur Verfügung stellt. So trabten ihre Rösser zum Beispiel im deutschen Fernsehfilm "Nibelungen" durchs Bild.
Nicht weit entfernt ist der Ort Diemersfontain bei Wellington. Dort hat Katrin Steytler einen kleinen Reitstall mit zehn Pferden. "Wir besuchen die älteste Olivenfarm der Kapregion", sagt die Reitführerin - kulinarische Genüsse sind bei den Ritten am Kap offenbar obligatorisch. Der Ausritt im klassischen englischen Sattel führt auch zu mannshohen Protea-Büschen. Es ist die Nationalblume Südafrikas, und sie wächst als riesiger Busch mit vielen Blüten.
"Afrika ist Abenteuer im Busch" - wer davon träumt, ist in der Kapregion allerdings falsch. Dazu muss man in andere Landesteile reisen oder einen Kompromiss eingehen: Zum Beispiel zwei Autostunden nordöstlich von Kapstadt in der Karoo ist das möglich. Mitten in einsamer Steppenlandschaft liegt dort das "Aquila Game Reserve" bei Touws River. In diesem Gehege lassen sich Wildtiere aus nächster Nähe auch vom Pferd aus beobachten.
Nashörner lassen sich durch Reiter nicht stören
"Unsere Tiere sind so sehr an Menschen gewöhnt, dass es sie nicht stört, wenn wir nahe heran reiten", erzählt Deon Gericke. Der Ranger nähert sich gerade mit einer Reitergruppe drei Nashörnern. Im Schritt geht es ganz langsam bis auf einige Meter an sie heran. Die sonst so scheuen Tiere bleiben tatsächlich stehen und lassen sich fotografieren. Die Pferde werden selbst in nächster Nähe zu gefährlichen Tieren nicht nervös, die reitenden Touristen schon eher.
Etwa 700 Tiere leben in dem Wildpark, darunter Springböcke, Gnus, Wasserbüffel und Warzenschweine. "Mit den Pferden kommen wir noch viel näher an die Tiere heran als mit den Jeeps", versichert Deon.
Wer Afrika-Anfänger ist und noch nie den wirklichen Busch durchritten ist, wird diesen durchaus touristischen Ritt genießen können. "Letztendlich ist es die Begegnung mit der Landschaft, der Natur und Kultur, was Reiturlauber in Südafrika suchen", beobachtet Sandra Noth, die mit ihrer Agentur "Hop-on-rides" speziell für deutschsprachige Reitaufenthalte im südlichsten Afrika organisiert.
 |
|
GMS
Südafrika: Die abwechslungsreiche Landschaft ist ein
ideales Ziel für Reiter |
Die täglichen Ausritte führen durch das 17 Quadratkilometer große Gelände in die Fynbos-Vegetation, wohlduftend mit Erikas, Pelargonien, Orchideen und wilden Kräutern. "Mit mehr als 700 Pflanzenarten haben wir ein einzigartiges Ökosystem", erklärt Michael Lutzeyer, einer der deutschstämmigen Besitzer. "Vor allem unser Wald mit seinen 1000 Jahre alten Milkwood-Bäumen ist einmalig."
Gischtreiten macht Pferde nervös
Im Schritt geht es dann den Hügel hinauf. Auf der ganzen Reitstrecke haben die Reiter einen hervorragenden Blick aufs Meer bis hin zum knapp 100 Kilometer entfernten Kap der Guten Hoffnung. Viel näher ist das Cape Agulhas, der südlichste Punkt des afrikanischen Kontinents. Dort treffen sich der Atlantische und der Indische Ozean.
Ein Ausritt direkt ans Meer ist erfahrenen Reitern vorbehalten. "Das ist ein etwas anspruchsvollerer Ritt", sagt Lutzeyer. In der Tat: Vom blauen Himmel brennt die Sonne, die Wellen schlagen hoch. Die Pferde wagen sich ein wenig ins Wasser und schrecken dann wieder vor der Gischt zurück. Der starke Wind wühlt das Wasser und die Pferdenerven auf. Da braucht der Reiter eine ruhige Hand. Doch schon ein paar Meter weiter weg wechselt das Verhalten der Pferde, und sie sind wieder lammfromme Arbeitstiere.
"Wie in "Grootbos" stehen in vielen Resort-Hotels Pferde für Ausflüge bereit", sagt Stefanie Sattler vom Deutschland-Büro von South African Tourism. "Reiten genießt in ganz Südafrika einen hohen Stellenwert, und das reichhaltige Angebot wird ständig erweitert."
Doch was wäre ein Südafrika-Urlaub ohne einen Abstecher in den Busch? Hoch zu Ross ist das ein besonderes Erlebnis. "Wenn ich vom Sattel aus Antilopen, Zebras und die anderen wilden Tiere beobachten kann, gerate selbst ich immer noch ins Schwärmen", erzählt Isabelle von Stepski. Die ausgewanderte Österreicherin ist die Besitzerin von "Pakamisa", einem 2500 Hektar großen Buschreservat, das auf einer Bergkuppe bei Pongola im Nordosten der Provinz KwaZulu-Natal liegt.
Neugierige Langhälse
Stepski geht mit Touristen auf selbst gezüchteten Arabern auf die Reitsafaris. Auch Anfänger können während einer Reittour auf ihrem Anwesen Wildtiere aus nächster Nähe beobachten. Etwas Geschick bedarf es allerdings schon, die scheuen Tiere aufzuspüren.
"Da vorne sind sie", ruft jemand aus der Reitergruppe. Neugierig schauen die Giraffen auf die Pferde herab. Eine ganze Weile lassen sie sich - verhalten und selbst etwas neugierig - bewundern. Plötzlich galoppieren sie, langbeinig und graziös, wie in Zeitlupe davon - und die Pferde gleich hinterher. Im Galopp mit Giraffen: Ein Reitertraum geht in Erfüllung.
Daniela David, gms
Zum Thema:
| Zum Thema in SPIEGEL ONLINE: |
http://www.spiegel.de/reise/metropolen/0,1518,380312,00.html http://www.spiegel.de/reise/fernweh/0,1518,379265,00.html http://www.spiegel.de/reise/fernweh/0,1518,350403,00.html |
SPIEGEL ONLINE - 28. August 2006, 11:14
URL: http://www.spiegel.de/reise/aktuell/0,1518,433099,00.html
Wein-Special
Von Gero von Randow
Merlot aus Mallorca, Bikavér aus Ungarn, Riesling aus Sachsen - Wein ist so vielfältig wie die Länder dieser Welt. Das Wein-Special unternimmt einen Streifzug durch Anbaugebiete von Kalifornien bis zum Kap. Heute: Die Winzer im modernen Südafrika setzen zunehmend auf den Stil des alten Europa.
Die gute Nachricht vorweg: Südafrikas Spitzenwinzer bringen in ihrer Mehrzahl elegante Rotweine hervor. Auch wenn einige der großen wineries, zum Beispiel Bushman's Creek, noch Getränke produzieren, die nach kalifornischem Kindergeburtstag schmecken - die besten Hersteller nehmen sich die europäische Stilistik zum Maßstab. Das belegen vor allem die Cuvées und die Pinot noir.
Zwar wachsen in der Kapregion auch schöne sortenreine Cabernet, Merlot und Syrah, etwa auf den Weingütern Flagstone, Neil Ellis, Rustenberg, Saxenburg, Slaley, Waterford und vor allem Springfield. Doch gerade dann, wenn die Afrikaner das Bordelais und Burgund im Sinn haben, erreichen ihre Weine wahre Klasse.
 |
|
Hendrik Holler
In Klein Constantia liegen Die
Rebflächen bis zu 300 Meter hoch
|
Zur Lese brennt die Sonne vom Himmel
Es ist kühl und windig hier, nahe gelegene Berge ziehen Wolken an, also auch Niederschläge. Auf dem Kalkboden, der über einer Wasser speichernden Tonschicht liegt, kämpfen dicht gepflanzte Burgunderreben um Nährstoffe - und bringen dabei den derzeit besten Pinot noir des Landes hervor. Allerdings muss auch hier, wie fast überall am Kap, der Boden bewässert und der Most nachgesäuert werden. Denn obwohl es in dieser Gegend wie in der Toskana aussieht, ist es eben doch Afrika, und im Februar, wenn gelesen wird, brennt die Sonne.
Finlaysons Pinot noir "Galpin Peak" überrascht in jüngeren Jahrgängen mit animalischem Bukett. Doch dann tritt in Duft und Geschmack feinste Frucht in den Vordergrund, etwas Schokolade ist auch dabei. Dieser Wein geht nach England; nach Frankreich hingegen exportiert Finlayson seine "Galpin Peak Tête de Cuvée" mit ihrem strengeren, komplexeren Stil, die es nur in guten Jahren gibt. Bemerkenswert: Schon 1994, da waren die Reben erst vier Jahre alt, brachte Finlayson einen Wein hervor, der auch heute noch kraftvoll und vielschichtig auftritt.
Finlayson hat seit Jahren am Kap einen großen Namen. Einst war er winemaker auf dem benachbarten Gut Hamilton Russell, wo es ebenfalls gute Pinot noir gibt, die aber nicht die gleiche Klasse haben. Möglich allerdings, dass neben den Veteranen Finlayson bald ein anderer seiner Generation tritt und ihm den Ruhm streitig macht: Jan Boland Coetzee aus Stellenbosch. Ihm gehören die Domaines Paradyskloof, die teilweise unter "Vriesenhof" vermarktet werden. Den ehemaligen Rugby-Star kennt in Südafrika jeder, und der 58-Jährige scheint immer noch in Topform zu sein, wenn er, nach präsentablen Fassproben suchend, über die aufgetürmten Barriques klettert.
Zwölf Jahre Vorbereitung für Pinot Noir
Bedächtig wie Peter Finlayson, scheu geradezu, nähert Coetzee sich den Besuchern. Ähnlich vorsichtig war er mit seinen Pinot noir - die hat er, der immerhin schon 1968 sein önologisches Diplom gemacht hat, erst kürzlich nach zwölf Jahren Vorbereitung auf den Markt gebracht. Verfügbar ist zurzeit der Jahrgang 2001, sehr burgundisch, durchaus leicht, gleichwohl charaktervoll. Demnächst erscheinen zwei 2002er Pinot noir mit Tiefe, Eleganz und Komplexität, und die 2003er Fassproben lassen strahlkräftige, geradezu klassische Weine erwarten.
Coetzee war auf seinen Besitztümern ein Sozialreformer, als das Land noch tief im Rassismus steckte. Immerhin, unter den Winzern gab es Gleichgesinnte, und heute finden sich gerade unter den besten solche, für die das Ende der Apartheid nicht bloß das Ende des marktzerstörerischen Boykotts, sondern auch den Anfang eines lebenswerteren Südafrikas bedeutet hat. Auf ihren Landgütern wohnen Arbeiterfamilien, die zumeist den sogenannten Farbigen, den coloureds, zugerechnet werden. Sie stammen nicht von schwarzen Afrikanern ab, sondern überwiegend von malaiischen Sklaven.
Die persönliche Abhängigkeit dieser Landarbeiter haben die neuen Gesetze gemindert. Etliche Weinproduzenten nutzen die veränderte Situation und motivieren ihre Land- und Kellerarbeiter, sich weiterzubilden und zum Teil auf eigenem Grund und Boden selber Wein anzubauen. Die Qualifikation, die dadurch entsteht, kommt letztlich der ganzen Branche zugute. Das ist auch die Strategie von Paul Cluver, der gleichfalls zur Avantgarde der Produzenten von Pinot noir europäischen Stils gehört.
Schwarze Afrikaner sind in der Kapregion weniger präsent als im Rest des Landes. Ihre Kultur ist dem Wein bisher ferngeblieben, doch das könnte sich ändern. So leitet beispielsweise eine junge Schwarze den Probenraum auf dem Gut Fairview des umtriebigen Charles Back (der auf seinen Etiketten zum Ärger der Franzosen gern die Côtes du Rhône zu "Goats do Roam", "Ziegen streifen umher", verballhornt).
Wein als Botschaft
Die schöne Frau, die sich als Bongi vorstellt, stammt aus den Slums von Durban, der großen Stadt im Nordosten. Nach dem Ende der Apartheid nahm sie sich vor, etwas zu erreichen. Sie hatte keine Ahnung von Wein, hatte aber zufällig gehört, dass Charles Back nicht auf die Hautfarbe, sondern auf Engagement und gute Arbeit Wert legte. So reiste sie Hunderte von Kilometern - und bekam ihre Chance. Mittlerweile hat sie schon Proben in Stockholm und auf der Düsseldorfer Messe ProWein geleitet. Ihr Ziel: "Ein Weingeschäft in Durban." - "Aber da wird doch kein Wein getrunken?" - "Eine Frage der Bildung. Und meine Leute dort kennen mich ja, die werden mir schon glauben, dass Wein etwas Gutes ist."
Die enormen Investitionen am Kap zeugen vom Vertrauen in- und ausländischer Firmen. Wer Weinberge kauft, kultiviert und noch dazu große Gutsgebäude errichtet, lässt sein Geld ja nicht auf kurzfristigen Abruf im Land. Wahre Paläste und Kellerkathedralen entstehen derzeit, und zuweilen fragt man sich, ob das nicht alles ein bisschen zu protzig daherkommt.
Doch die Qualitäten überzeugen, nicht zuletzt bei den roten Cuvées nach europäischem Vorbild. Sie kommen aus Weingütern wie Klein Constantia, Veenwouden, Vergelegen und Morgenster. Deren Blends beginnen dem Pionier dieses Genres, dem Gut Rust en Vrede, den Rang abzulaufen. Und demnächst könnte das, was in den Fässern des kapitalkräftigen Newcomers Quoin Rock lagert, zur Spitze vorstoßen.
Qualität zeigt sich nicht zuletzt daran, ob ein Weingut außer einzelnen Spitzen auch ein ganzes Spitzenprogramm zu bieten hat. In dieser Disziplin führt Boekenhoutskloof aus Franschhoek, aber das vielseitigste Angebot präsentiert der quirlige Bruce Jack. Sein Weingut Flagstone bringt sehr persönliche Spitzenweine hervor, auch einen opulenten Pinot noir namens "Poetry Collection".
Das interessanteste Projekt dieses Mannes, der offenbar an mehreren Orten gleichzeitig zu sein vermag, ist jedoch die Gründung einer neuen Weinregion im rauen Seeklima von Elim, gemeinsam mit drei schwergewichtigen, bärtigen Naturburschen, die bisher Schafe gezüchtet haben. Die freundlichen Bären, denen Bruce Jack an Leibesumfang nicht nachsteht, arbeiten an Marken mit maritimen Namen wie "Land's End" und "The Berrio" - so hieß das erste Schiff, das einst das Kap umfahren hat. Bald schon könnte diese neue Wein-Armada ganz vorn in der heimischen Produktion segeln.
Die Zeiten sind also vorbei, in denen südafrikanischer Roter lediglich "noch so ein Wein aus Übersee" war. Man kann ihnen nur die Daumen drücken: Bruce, Bongi - und dem ganzen Land.
Zum Thema:
| Zum Thema in SPIEGEL ONLINE: |
http://www.spiegel.de/reise/aktuell/0,1518,388007,00.html http://www.spiegel.de/reise/kurztrip/0,1518,377599,00.html http://www.spiegel.de/reise/kurztrip/0,1518,373894,00.html |
SPIEGEL ONLINE - 22. November 2006, 06:13
URL: http://www.spiegel.de/reise/fernweh/0,1518,449890,00.html
Von Elke Naters
Kapstadt muss man sich nähern wie einer Geliebten: Lächle sie an, dann lacht sie zurück. Alle Widersprüche und Vorurteile lässt sie vergessen. Sie zeigt Temperament und Vielfalt, verwöhnt mit Szene-Glamour und edelster Küche. Sie kostet Energie - und macht glücklich.
Stell dir vor: eine Stadt voller Leben. Am Meer. In den Bergen. Mit einem Blick über die halbe Welt. Farben, Licht, Musik, bunte Menschen. Kultur, Natur, Lärm, Stille. Alles an einem Ort zur gleichen Zeit. Gibt es nicht, muss erst noch erfunden werden! Irrtum. Ist alles schon da: in Kapstadt!
Es gibt keine schönere Stadt, keine wildere, keine, die so viele Widersprüche in sich vereint. Jeder, der aus Kapstadt kommt, erzählt eine andere Geschichte. Hüte dich, diese Stadt schlecht gelaunt und voller Vorurteile zu besuchen! Behandele sie wie eine Geliebte! Lächle sie an, dann lacht sie zurück! Und ertrage geduldig ihre Launen, wenn der Southeastern an deinen Haaren und Nerven zerrt!
Victoria & Alfred Waterfront: Viele Touristen gehen ausschließlich in dem Einkaufs- und Amüsierviertel bummeln

Camps Bay: Die Villen unterhalb der Bergkette der Zwölf Apostel gehören zum Viertel der Reichen und Schönen

Blick vom berühmten Hausberg: Der Tafelberg bei Kapstadt ist 1087 Meter hoch
Surfers Paradies: Die Küsten rund ums Kap bieten beste Bedingungen für den Wind- und Wellensurfer
Wo nur anfangen? Am besten an der Ostküste vor der Stadt. In Muizenberg, wo die Sonne aufgeht, das Meer lockt. Der kleine Küstenvorort ist eine charmante Mischung aus Malerisch und Runtergekommen. Aus Surfshops, Backpackerhotels, Cafés. Hier an der False Bay ist der Himmel blitzblau, rollen die perfekten Anfängerwellen sanft an den Strand - wer hier das Surfen nicht lernt, lernt es nirgendwo.
Eigentlich wollte ich mich nur umsehen, aber die Leute vom "Surfshack" überreden mich zu einer Stunde. Sie kamen vor zehn Jahren hierher, weil die Industrieluft im Hinterland ihre Kinder krank gemacht hatte. Sie eröffneten den Shop und eine Surfschule für Mädchen, als ihre Tochter zu surfen begann - das einzige Mädchen in den Wellen. Inzwischen ist sie 16, reist um die halbe Welt zu Wettbewerben. "Aber", mahnt die Mutter, "nur, wenn die Schule nicht darunter leidet! Die Tochter hockt hinter dem Tresen am Computer und stöhnt über den Hausaufgaben: Shakespeare, "Romeo und Julia", wer braucht das schon?
"Paddelpaddelpaddelpaddel!!"
Die Surfschule bietet inzwischen ein Jedermannprogramm, vor allem für Familien. Aus dem Wasser kommt gerade eine Gruppe gut gelaunter Hausfrauen um die 40, die ihre erste Stunde hatten. Eine Geburtstagsparty. Was die können, kann ich auch! Wetsuit gegen kaltes Wasser und Surfboard kann man leihen. Mein Surflehrer Dave gibt eine kurze Sicherheitseinweisung, pflichtgemäß warnt er vor Haien: Hier sind die "Great Whites" zu Hause, sie haben sogar Namen - einer heißt Submarine. Menschenfleisch steht üblicherweise nicht auf ihrem Speiseplan, auch wenn man letztes Jahr von einer alten Dame, die zu weit hinausgeschwommen war, nur noch die Badekappe fand. Dave beruhigt mich: Oben in den Bergen sitzt ein Mann mit Ferngläsern. Sieht er einen Hai, bedient er eine Sirene, und es bleibt genug Zeit, um ans Ufer zu kommen.
Dave zeigt mir am Strand, wie ich aufs Brett aufspringen muss, wie ich die Hände schützend über den Kopf lege, sobald ich vom Board falle. Dann geht es ins Wasser. Ich paddele aufs Meer hinaus, bringe mich in Position, warte auf die Welle. Plötzlich ruft Dave: "paddelpaddelpaddelpaddel!!", und ich spüre, wie die Welle mich erfasst, mich anschiebt. Ich versuche, auf die Beine zu kommen, schaffe es nur auf die Knie, aber das ist mir egal. Auf allen Vieren gleite ich über das Wasser und schreie vor Glück.
Surfen ist großartig. Und brutal anstrengend. Im Surfshop warten eine warme Dusche und eine heiße Schokolade, der Atlantik ist auch in der heißen Jahreszeit grundsätzlich eiskalt. Wem das Wellensurfen nicht genügt, der kann windsurfen in Misty Cliffs bei Scarborough oder kitesurfen an der Westküste, wo der Wind mit 100 Stundenkilometern bläst: Das Formel-1-Revier der Surfer nennen sie es. Auch sonst gibt es reichlich Möglichkeiten für einen Endorphinkick. Rund um Kapstadt kann man sich austoben, das Angebot reicht von A wie Abseiling (am Seil vom Tafelberg herunter) bis W wie Wakeboarding (Snowboarding auf Sanddünen).
Schräge Songs auf selbst gebauter Gitarre
Glücklich und hungrig fahre ich wenige Kilometer weiter nach Kalk Bay, dorthin, wo sich Kapstadts Boheme vom Stadtleben erholt. Die hübschen kleinen Häuser wurden vor über hundert Jahren steil an den Berg gebaut. Lazy afternoon - am Hafen esse ich Fischtatar, sehe den Anglern zu, wie sie nichts fangen. Ein Fotograf kommt mit drei schwarzen Models und einem Haufen weißer Assistentinnen, die an deren Kleidern rumzupfen. Die Mädels stellen sich auf dem Pier in Pose. Im Hintergrund nimmt eine Frau in geblümter Schürze einen Fisch aus. Schwarze Jungs spielen auf einer selbst gebauten Gitarre aus Brettern und Schnüren und singen schräge Songs. Einer der Sänger trägt seine Kleider verkehrt herum: die Bomberjacke mit dem orangefarbenen Futter nach außen und die nach links gekehrten Taschen hängen aus der Jeans - African street style.
Weiter zu Konrad nach Green Point, im Herzen von Kapstadt, einem typischen Einwanderer: Er, Filmemacher aus Berlin, ist seit fünf Jahren mit der Südafrikanerin Lydia verheiratet. Sie arbeitet als freie Journalistin. Konrad hat seinen Job bei Lufthansa gekündigt, dort saß er mit anderen Deutschen - "überqualifizierte Aussteiger aus allen Berufen, wirklich interessante Leute" - in einem engen Büro, kontrollierte am Bildschirm die Gewichtsverteilung im Gepäckraum deutscher Flugzeuge. Gab er in Kapstadt sein Okay, konnte die Maschine in Frankfurt starten.
Konrad hat wie viele Kapstädter den Beruf gewechselt. Zurzeit arbeitet er an seiner neuen Karriere: Konrads wahre Leidenschaft sind Käsekuchen - er ist auf der Suche nach der perfekten Torte und froh, wenn jemand kommt, um zu probieren. So sitzen wir in der großen Küche des viktorianischen Hauses und suchen nach einer Idee, wie er seinen Kuchen vermarkten könnte.
Konrads Jobwechsel hat politische Gründe: Durch die Quotenregelung werden seit Ende der Apartheid Schwarze und Coloureds bei qualifizierten Jobs bevorzugt. Viele junge Weiße wandern deshalb nach England, Kanada, Australien aus. Die einzige Möglichkeit, hier bleiben zu können - also Geld zu verdienen -, ist ein eigenes Business. Konrads Schwiegereltern wollen den beiden ein Haus in Europa kaufen, denn wie viele weiße Kapstädter vom alten Schlag sehen sie keine Zukunft für ihre Kinder in Südafrika. Konrad und Lydia sind da anderer Meinung: Nichts auf der Welt wird sie aus Kapstadt wegbringen!
Städtisches Modedesign, inspiriert von traditionellen Gewändern
Sally ruft an, wir verabreden uns im "Vida e caffeé" auf der Kloof Street im Stadtteil Tamboerskloof. Noch vor drei Jahren waren die Straßen hier nachts menschenleer, allenfalls bevölkert von finsteren Gestalten. Jetzt sind die Straßencafés und Bars des Viertels am Samstagabend voller Menschen: schöne, junge, reiche Schwarze in teuren Autos, weiße Surfer in Flipflops mit sonnengebleichten Dreadlocks, eine Gruppe moslemischer Mädchen schnattert am Nebentisch. Hier zeigen sich das stolze schwarze Afrika und ein nicht minder verzagtes weißes, das keine Berührungsängste mehr kennt.
Sally ist 27, hat ein abgeschlossenes Wirtschaftsstudium hinter sich. Sie spricht drei Sprachen, betreibt mit einer Freundin eine Cateringfirma, hat einen Winzer geheiratet: all das macht sie in Südafrika heute zur Prinzessin. Und so sieht sie auch aus in ihrem Kleid von "Sun Goddess". Afro-urban aesthetic wird die Mode der südafrikanischen Designer genannt. Städtisches Design, inspiriert von traditionellen Gewändern der Zulu, San, Xhosa.
Sally kommt gerade von einer Hochzeit. Ausnahmsweise hat sie dort nicht gekocht, sondern gegessen. Sally kocht für VIPs und Kapstadts Oberschicht. Für den alten Geldadel in Constantia, bei dem die Zeit stehen geblieben zu sein scheint: in prächtigen Kolonialvillen für dürre ältliche Ladys, die ihr nicht in die Augen sehen und sie behandeln wie deren Vorfahren vor hundert Jahren ihre Bediensteten.
Oder sie wird engagiert von den Neureichen in Clifton und Camps Bay: Leute, die ihr Geld in den Medien, mit Immobilien verdienen, in kreativen Berufen arbeiten. "Jünger, sehr viel angenehmer. Leute mit Stil und Geschmack", sagt Sally. "Die haben begriffen, dass man Menschen egal welcher Stellung oder Hautfarbe respektiert." Sie erzählt von einem Wettkochen für Leonardo DiCaprio, der in Südafrika drehen wird und nach dem richtigen Caterer sucht. Das Namedropping-Spiel ist auch in Kapstadt hip.
Zum Sundowner nach Camps Bay
Wir fahren nach Camps Bay, weil Goldfish heute Abend im "Baraza" spielt. Das Duo ist angesagt, gilt als das kommende große Ding in der Elektromusik, auch wenn Camps Bay nicht unbedingt der Ort ist, an dem man nachts ausgeht. Hier treffen sich die Reichen zum Sundowner und alle, die gern das Geld oder nur die Sonne untergehen sehen wollen. Die beiden Musiker vermischen klassische Instrumental- und elektronische Musik zu einem ganz eigenen Afro-Jazz-House.
Letzte Woche, als sie im "Opium" - Kapstadts größter und angesagtester Disco - spielten, tobte das Haus. Heute tanzt nur ein einsamer junger Mann zwischen den Tischen. Wir brechen auf, um einen Absacker im "Hemisphere" zu trinken, einer Bar im 31. Stock des ABSA-Bankgebäudes. Der Dresscode ist streng: "No Jeans, no T-Shirts". Und der Blick durch die Panoramfenster auf das nächtliche Kapstadt ist atemberaubend.
Unten auf der Erde unterhält sich der Parkwächter mit einem Tänzchen auf der leeren Straße. "Have a beautiful night, ladies!" ruft er uns nach.
Zum Thema in SPIEGEL ONLINE:
SPIEGEL ONLINE - 13. Dezember 2006, 09:12
URL: http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/0,1518,448170,00.html
Tauchen im Indischen Ozean, Sonnenuntergang auf dem Tafelberg, Weinproben an der Uni - VWL-Student Alexander Schwan, 21, fühlt sich in Südafrika wie im Paradies. Die Kehrseite: Täglich erlebt er krassen Rassismus seiner weißen Kommilitonen.
Die Kulisse ist fast unfassbar schön. Die Sonne scheint, gleich hinter dem Uni-Gebäude strecken sich grüne Weinplantagen auf den Ausläufern mächtiger Berge. Die Stimmung auf dem Campus ist weniger idyllisch. Weiße Studenten stehen in Gruppen und lassen farbige Kommilitonen links liegen. Sätze wie: "Ich höre keine Rapmusik, die ist von Schwarzen gemacht" verderben mir die Stimmung.
Der Rassismus ist hier jeden Tag spürbar. Und das in einem Land, das die Rassentrennung 1994 offiziell abgeschafft hat. Südafrika ist Paradies und Hölle zugleich.

Student Alexander Schwan, 21, am Bloubergstrand: "Die Pilgerstätte fürs perfekte
Südafrikafoto" mit der Skyline Kapstadts und Tafelbergkulisse.

Weingebiet Stellenbosch: Weinbau ist in der 105.000-Einwohner-Stadt neben
Tourismus der wichtigste Wirtschaftsfaktor, an der Universität gibt es eine
Wein-Fakultät.


"Harvard Afrikas": Der schmeichelhafte Zweitname der Universität Stellenbosch
hat nicht nur mit der Architektur, sondern auch mit der Hautfarbe der Studenten
zu tun.
Hinten Weinberge, vorne Wellblech: Das Township "Khayamandi" liegt direkt vor
der Stadtgrenze Stellenboschs.
In Stellenbosch, wo ich seit Juli für ein Semester Volkswirtschaft und Politik studiere, dreht sich alles um Wein. Shiraz, Merlot, Pinotage, hier werden Spitzentropfen angebaut. Die Uni bildet Star-Winzer aus. An der Wine-Faculty habe ich die Grundlagen des Weintestens und der Weinproduktion kennen gelernt. Abends bei Straußenfilet und Cabernet Sauvignon dem Plätschern des Wassers am Eerste River lauschen und den vom Sonnenuntergang rot erstrahlten Tafelberg am Horizont ausmachen - das ist der paradiesische Teil.
"Ja, ich bin rassistisch!"
Aber da ist noch die andere, hässliche Seite Stellenboschs. Die Eliteuni wird wegen ihrer schönen, alten Gebäude und der Qualität der Ausbildung als "Harvard Afrikas" bezeichnet. Bis 1994 war die Universität ausschließlich für Weiße zugänglich, und viele Studenten verhalten sich, als wäre die Zeit stehen geblieben.
Mehr als zehn Jahre später sind immer noch 80 Prozent der Studenten weiß. Rassismus gehört weiterhin zum Alltag. "Die Kriminalität auf den Straßen ist der Preis für die Demokratie", so reden die Maties, wie die Stellenboscher Studenten genannt werden. Oder geben ganz offen zu: "Ja, ich bin rassistisch!"
Die Uni versucht krampfhaft, Afrikaans - die Sprache der weißen Bevölkerung - als einzige Unterrichtssprache im Grundstudium beizubehalten. Auch im Alltag der Stadt ist die Rassentrennung immer noch spürbar. Wo Weiße ihre gut bezahlten Jobs in den Büroetagen bekommen, müssen sich Farbige mit Hungerlöhnen für minderwertige Arbeit zufrieden geben. Das so oft gepriesene "Nation Building" scheint in Stellenbosch noch nicht stattgefunden zu haben.
Eine Fahrt nach Kapstadt zeigt schnell, dass Stellenbosch nicht die Ausnahme ist. Im Gegenteil: Die Kontraste sind in der Millionenstadt noch viel drastischer. Binnen weniger Kilometer wechselt das Erscheinungsbild von Luxuswohnungen am Strand von Camps Bay zu den nicht enden wollenden Blechhüttenreihen in den Vororten, wo Millionen Menschen auf ihrer Suche nach Arbeit gestrandet sind.
"We are one nation", sagt Desmond Tutu
Beim Anblick dieser ungerechten Armut läuft mir ein kalter Schauer über den Rücken. Eine ohnmächtige Wut macht sich breit. Und doch lächeln sie mich an, die Slum-Bewohner, mit denen ich über Armut und Reichtum in Südafrika rede. Ihr "Ubuntu" - die Lebensfreude und der Zusammenhalt untereinander - scheint stärker zu sein als die Ausweglosigkeit.
Die Kriminalitätsrate in Südafrika ist unglaublich hoch. Nie fühlt man sich völlig sicher, Überfälle sind an der Tagesordnung. Kommilitonen wurden von Jugendbanden ausgeraubt. Ich habe sogar Schüsse im Supermarkt nebenan mitbekommen. "Ich rette lieber mein eigenes Leben, bevor ich das eines anderen rette", sagte mir ein Wachposten hinterher.
Und am nächsten Tag freue ich mich trotzdem wieder, hier sein zu dürfen, in der zweitältesten Stadt Südafrikas. Das Level in der Hochschule ist zwar nicht so hoch wie an meiner Heimatuni in Maastricht, aber ich kann einmal ganz andere Themen studieren: zum Beispiel Gerechtigkeit in Krisenländern wie Ruanda, die Auswirkung der Globalisierung auf den afrikanischen Kontinent - und eben die Probleme bei der Errichtung einer demokratischen Nation in Südafrika seit 1994.
In puncto Freizeit liegt Südafrika klar vorn. Im Indischen Ozean kann man nach Walen und Haien tauchen, die bizarren Felsformationen der Zederberge sind toll zum Wandern, und in der Halbwüste von Oudtshoorn satteln Südafrikaner Strauße zum Ausritt.
Kürzlich habe ich den Nobelpreisträger Erzbischof Desmond Tutu, neben Nelson Mandela der Übervater Südafrikas, bei einem Vortrag zur Geschichte der "Rainbow-Nation" erlebt. Ich war beeindruckt, als dieser kleine und dennoch so große Mann zur unabdingbaren Integration aller Südafrikaner aufrief. "We are one nation!" Wenn er doch nur Recht hätte.
Zum Thema in SPIEGEL ONLINE:
SPIEGEL ONLINE - 13. Februar 2007, 08:43
URL: http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/0,1518,461694,00.html
Von Corinna Arndt, Johannesburg
Gestern schliefen sie noch in einer Wellblechhütte im Township, heute sitzen sie im Hörsaal: An der Cida City-Universität in Johannesburg können schwarze Studenten aus armen Familien fast kostenlos BWL studieren - und die Wirtschaft reißt sich um die Absolventen.
Die Studenten in der lichtdurchfluteten Mensa der Cida City-Universität tragen polierte Schuhe und frisch gebügelte Hemden. Soeben haben sie die letzte Klausur des Semesters geschafft, überall sieht man entspannte Gesichter. Vor der Tür tobt der Verkehr durch die berüchtigte Johannesburger Innenstadt, die seit Jahren für Kriminalität steht, für urbanen Verfall und eine düstere Zukunft. Der Kontrast zwischen draußen und drinnen könnte größer nicht sein.
Die Studenten haben einiges gemeinsam: Sie haben ihr Abitur mit Auszeichnung hingelegt, sind so arm, dass sie sich ein Studium an einer südafrikanischen Uni eigentlich nie leisten könnten - und sehen dennoch einer glänzenden Zukunft entgegen. An der Cida-Hochschule für Betriebswirtschaft ist das Studium praktisch kostenlos.
Davon profitiert auch der schlaksige Lucky Mdontsela aus einer Slumsiedlung bei Johannesburg. Bei einer landesweiten Arbeitslosenrate von rund 40 Prozent fand er nach der Schule vier Jahre lang keinen Job, dann klappte es mit der Cida-Bewerbung. "Als ich hier ankam, habe ich mich dafür geschämt, dass ich in einer Wellblechhütte aufgewachsen bin, mit neun Leuten in der Familie", sagt Mdontsela, "ich habe auf dem Boden geschlafen." Heute schwingt Stolz in seiner Stimme mit, wenn er vom Elternhaus erzählt - schließlich entscheide er nun selbst über seine Zukunft.
Vom Tellerwäscher zum Finanzexperten
Die hat der 23-Jährige sich bereits ausgemalt: In drei Jahren will er mit dem BWL-Abschluss in der Tasche als Bilanzbuchhalter bei einer großen Firma anheuern und sich danach als Unternehmer selbstständig machen. Ähnlich große Pläne hat seine Kommilitonin Babalwa Damoyi. Die rastabezopfte junge Frau strotzt nur so vor Selbstbewusstsein. Ihr Ziel im Leben? "Extrem erfolgreich sein!" Am liebsten in der Kommunikationsbranche, aber auch an Logistik und Management hat sie Interesse. "Außerdem möchte ich irgendwann mein eigenes Ferienhaus haben und eine Kette von Schönheitssalons", sagt sie - und wischt mit einer Handbewegung alle Zweifel beiseite.
Doch zunächst heißt es Büffeln. Täglich verbringen Lucky, Babalwa und ihre rund 1500 Kommilitonen acht Stunden in Lehrveranstaltungen. Die Vorlesungen sind so vollgestopft, dass der Vortrag des Dozenten per Fernsehschirm in die hinteren Reihen übertragen wird. Abends wird zu Hause weitergelernt, gegen den Stress hilft regelmäßiges Meditieren. Alle wissen: Cida-Absolventen haben beste Chancen auf Südafrikas Arbeitsmarkt, denn es mangelt chronisch an schwarzen Finanzexperten.
Dafür studieren sie nicht nur Tag und Nacht, sondern managen nebenbei die gesamte Uni selbst - zum Beispiel als Tellerwäscher in der Mensa im achten Stock. Seit vor einigen Jahren Studenten in der Vorlesung vor Hunger ohnmächtig wurden, gibt es jeden Tag kostenloses Mittagessen. So stellen sich die angehenden Führungskräfte selbst in die Küche: Wer nicht gerade kocht, fegt den Hörsaal, schrubbt Treppen, bepflanzt den Dachgarten, sortiert Akten im Sekretariat oder kümmert sich um die Öffentlichkeitsarbeit der Uni.
Zehnmal so viele Bewerber wie Plätze
Die Eigeninitiative der Studenten spart viel Geld. Ein Cida-Studium kostet 240 Euro Studiengebühren im Jahr, an anderen Unis des Landes sind es 20-mal so viel. Für den Rest kommen Unternehmen auf. Die Liste der Spender liest sich wie das Who's who der südafrikanischen Telekommunikations- und Finanzbranche. Selbst Virgin-Gründer Richard Branson zückte den Geldbeutel, und am Kap aktive deutsche Firmen wie DaimlerChrysler, T-Systems oder der Textilunternehmer Claas Daun spenden Sachgüter und Millionenbeträge.
Am Ende profitiert neben der Uni auch die Industrie, denn ohne schwarze Führungskräfte im Management kommen Firmen in Südafrika kaum noch an lukrative Regierungsaufträge heran. Der Nachwuchs aber ist heiß umkämpft - und glücklich der, der sich jedes Jahr die besten Cida-Absolventen herauspicken darf. Hunderte haben den Sprung in die Businesswelt bereits geschafft. "Kein Wunder", meint einer der Dozenten stolz - so forsche, kreative und wissbegierige Studenten habe er noch nie gehabt.
Kein Zweifel: Die erste quasi-kostenlose Universität südlich der Sahara ist ein Erfolgsmodell. 70 bis 90 Prozent aller Studienanfänger schaffen ihr Examen, nur jeder zehnte Bewerber erhält einen Studienplatz. Was in Johannesburg so gut funktioniere, das habe auch eine Zukunft in anderen Städten des Landes und im Rest Afrikas, behauptet Taddy Blecher. Der Cida-Gründer und Geschäftsführer wäre vor zwölf Jahren fast nach Amerika emigriert - und hat sich heute ganz der Zukunft Afrikas verschrieben.
"Mir war nie klar, dass ich ein Vorbild sein kann"
"Viele Leute haben den Kontinent doch aufgegeben", sagt Blecher. Man habe Mitleid mit den Afrikanern, schicke ihnen Medizin und Essen, und Bob Geldof veranstalte ein großes Konzert. Nachhaltig sei das alles nicht. Sein Ansatz ist anders: "Wir können Afrika nur helfen, wenn wir an die Afrikaner glauben und in die Menschen hier investieren", so der Preisträger des "Global Leader of Tomorrow Award" beim Weltwirtschaftsforum in New York. "Die Probleme in Südafrika sind doch offensichtlich: Kriminalität, Armut und ein riesiger Graben zwischen Arm und Reich. Für diese Probleme brauchen wir innovative Lösungen."
Eine der Cida-Innovationen ist es, die Studenten regelmäßig in den Semesterferien zurück in ihre Heimatdörfer zu schicken, damit sie ihr Wissen dort weitergeben können. Für Lucky Mdontsela gehört es zu den Highlights seines Studiums, mit Schülern seiner früheren Schule über den Umgang mit Computern, Geld oder Aids zu sprechen. "Jeder von uns ist Mentor für mindestens 30 Schüler. Mir war nie klar, dass ich ein Vorbild für andere sein kann. So ein Vorbild, das ist etwas, das ich als Schüler nie hatte."
Cida-Chef Blecher schätzt, dass die über 2000 Alumni im kommenden Jahr gemeinsam umgerechnet rund 14 Millionen Euro verdienen werden. Ein Großteil davon, soviel ist sicher, fließt direkt zurück in die ärmsten Dörfer und Townships Südafrikas - ein Hoffnungsschimmer für ein Land, in dem sich wirtschaftliche Umverteilung normalerweise auf politische Statements am Kabinettstisch beschränkt.
Zum Thema in SPIEGEL ONLINE:
Von Karl-Ludwig Günsche, Kapstadt
Gewalt, Armut, explodierende Preise und eine unsichere Zukunft - Südafrika rutscht immer tiefer in die Krise. Hoffnung auf Besserung haben nur wenige: Immer mehr Spitzenkräfte kehren dem einstigen Wunderstaat des schwarzen Kontinents den Rücken.
Kapstadt - Es war wie an jedem Morgen. Tony Williams war mit ihren beiden Töchtern Emily und Sophie um sieben Uhr morgens auf dem Weg zur Schule. Doch als sie im ruhigen Johannesburger Viertel Fairlands noch ein Nachbarskind aufsammeln wollte, gerieten sie und die Kinder in eine Schießerei zwischen Gangstern und Mitarbeitern einer privaten Sicherheitsfirma. Die zwölfjährige Emily wurde von einem Querschläger getroffen und starb.
Zwei Monate zögerte ihr Vater Roger Williams, Finanzchef eines Chemiekonzerns. Dann kündigte er öffentlich an, dass er mit seiner Familie Südafrika verlassen werde. "Wir haben lange darüber gesprochen, weil wir ja auch eine Menge aufgeben müssen", sagt er. Seit 17 Jahren leben die Williams schon in Johannesburg. Sie haben sich etwas geschaffen. "Aber die meisten unserer Freunde und Bekannten wollen gehen", sagt der Familienvater. "Das ist schade für dieses Land. Denn das sind alles Leute mit hervorragenden Qualifikationen, die hier auch viel investiert haben."
Der Fall der Familie Williams hat Schlagzeilen gemacht. Meist aber vollzieht sich der Exodus aus dem einstigen Wirtschaftswunderland am Kap, der Regenbogennation Nelson Mandelas still, unauffällig und schweigend. So überraschte der deutsche Arzt Wolfgang K. in Kapstadt seinen Patienten eines Tages mit der Mitteilung, dass er seine seit 14 Jahren erfolgreiche Praxis verkauft habe und sich in Australien eine neue Existenz aufbauen werde.
Der Bochumer Werkzeugmacher Gerhard J. war sogar schon in den sechziger Jahren ans Kap gekommen, hatte sich ein florierendes Unternehmen aufgebaut, eine Südafrikanerin aus einer alteingesessenen Burenfamilie geheiratet und nie daran gedacht, dass er seine neue Heimat wieder verlassen würde. Doch statt in seinem Riesenanwesen in Kapstadt will er mit seiner Frau lieber irgendwo in Europa alt werden, "irgendwo, wo es sicher ist und wo ich weiß, dass mein investiertes Kapital mir auch morgen noch gehört". Er gibt zu, dass die fremdenfeindlichen Unruhen im Mai für ihn die sprichwörtlichen Tropfen gewesen seien, die zu seinem endgültigen Entschluss geführt hätten, Südafrika den Rücken zu kehren.
Das Land beginnt auszubluten
Konsulate und Botschaften der Haupteinwanderungsländer Australien, Neuseeland, Großbritannien und USA verzeichnen eine sprunghaft gestiegene Nachfrage nach Einwanderungsvisa. Auch Ofer Dahan vom Israel Zentrum in Johannesburg beobachtet diesen "wachsenden Trend": Im gesamten Jahr 2006 seien 108 Juden aus Südafrika nach Israel ausgewandert. In den ersten vier Monaten dieses Jahres aber haben sich bereits 350 ernsthaft um eine Auswanderung allein nach Israel bemüht - vorwiegend junge, gut ausgebildete Spezialisten.
Das Land am Kap beginnt auszubluten. Allein die südafrikanische Luftwaffe musste in den ersten Monaten dieses Jahres einen Aderlass hinnehmen, der kaum wettzumachen ist: Mindestens 50 hoch spezialisierte Flugzeugingenieure und Techniker kündigten, um sich im Ausland eine neue Zukunft aufzubauen. Zehn Techniker der Airbase Ysterplaat bei Kapstadt wollen mit ihren Familien Südafrika Ende Juni in Richtung Australien verlassen, 20 Flugzeugingenieure haben diesen Schritt bereits Ende Mai getan. Die Gründe sind fast immer dieselben: "Die Kriminalität, die steigenden Lebenshaltungskosten und die schlechten Arbeitsbedingungen."
Südafrika ist in eine Krise geraten, die sich seit langem abgezeichnet hat, die aber dennoch tiefer ist, als viele es noch vor wenigen Monaten für möglich gehalten haben.
Aufgeladene Stimmung
Die Ursachen sind vielfältig: Die Wahl des schillernden und skandalumwitterten Populisten Jacob Zuma im Dezember 2007 zum Präsidenten der Regierungspartei ANC, der damit ab 2009 wahrscheinlich zum neuen Staatsoberhaupt wird, hat viele, vor allem weiße Südafrikaner verunsichert.
Dazu kam die Energiekrise des Landes, die Stromausfälle, die der staatliche Energieriese Escom nicht in den Griff bekam. Die ausufernde Kriminalität, die weltweit höchste Aids-Rate, wachsende Armut, ein desolates öffentliches Gesundheitssystem, die explodierenden Verbraucher- und Energiepreise, die kaum oder gar nicht integrierten rund fünf Millionen Flüchtlinge aus anderen afrikanischen Ländern, 40 Prozent Arbeitslosigkeit - als dies ergibt eine gefährliche Mischung, die die hasserfüllten Pogrome im Mai zusätzlich befeuerte.
In einer derart emotional aufgeladenen Stimmung ist es dann wie ein schmerzhafter Nadelstich, wenn eher unbedeutende Funktionäre wie der Vorsitzende des Jugendkulturclubs Uhuru in Pretoria, Faraday Nkoane, vor rund hundert Jugendlichen dazu aufrufen, den Weißen das Land zu stehlen: "Es ist Euer Recht, das zu tun. Denn die Weißen haben den Schwarzen das Land geraubt."
Noch verheerender wirkt es, wenn der Präsident der ANC-Jungsozialisten, Julius Malema, angesichts des drohenden Korruptionsprozesses gegen den ANC-Präsidenten lautstark verkündet: "Wir sind bereit, für Zuma zu sterben. Wir sind bereit, zu den Waffen zu greifen und für Zuma zu töten."
Die Wirtschaft schwächelt, die Regierung reagiert hilflos - die Hoffnungen ruhen auf der Fußball-WM
Die Auswirkungen der allgemeinen Verunsicherung sind nicht nur an den Auswanderungszahlen ablesbar. Der Wirtschaftsteil der angesehenen Tageszeitung "Cape Times" erschien Anfang Juni mit der knalligen Überschrift "Hauspreise vor dem freien Fall". "Die Kombination von verzweifelten Verkäufern, weniger Käufern und zunehmend vorsichtigeren Banken könnte den Markt knacken", analysierte das Blatt. Immobilienmakler geben an, die Verkaufszahlen seien Anfang 2008 um 30 Prozent abgesackt. In den vergangenen elf Jahren seien die Preise nie so schnell verfallen.
Das Wirtschaftswachstum, sonst immer stabil zwischen fünf und sechs Prozent, liegt in diesem Frühjahr nur noch knapp über zwei Prozent. Die Verbraucherpreise sind explodiert, der Randkurs ist im Keller. Jeden Monat kommen 2000 Immobilien unter den Hammer. Martin Feinstein, Vorstandsmitglied in einer südafrikanischen Mittelstandsvereinigung, prophezeit: "Die kommenden 18 bis 24 Monate werden für die kleinen und mittleren Unternehmen die Hölle."
Der Wirtschaftsexperte Mike Schussler warnt: "Es wird noch viel schlimmer, bevor es wieder besser wird. Es ist schwer vorherzusagen, wie schlimm es wird und wie lange es dauern wird." Gerade hat die internationale Rating-Agentur Finch Südafrika wegen der unsicheren politischen und wirtschaftlichen Lage herabgestuft.
"Wir haben versagt"
Selbst Präsidentenbruder Moeletsi Mbeki fragt entsetzt: "Warum halten wir diesen Niedergang unserer Nation nicht auf?" 14 Jahre nach dem Ende der Apartheid sagt jeder fünfte Südafrikaner, dass er zu arm sei, um sich ausreichend zu ernähren. Bei den Schwarzen gibt ein Drittel an, sie hätten nicht genügend Lebensmittel, um über die Runden zu kommen. Die Zahl der Sozialhilfeempfänger ist in diesem Jahr um zwei Millionen gestiegen. Insgesamt beziehen 12,8 Millionen der knapp 50 Millionen Südafrikaner staatliche Unterstützung. Der Vorsitzende der südafrikanischen Entwicklungsbank und frühere Minister Jay Naidoo kommt zu dem bitteren Fazit: "Wir haben als Führer in den Townships, in den Organisationen, als Regierung und als Gesellschaft versagt."
Die Versuche der Regierung, das Ruder herumzureißen, muten eher hilflos an. So sollen zum Beispiel Ingenieure und Architekten aus Kuba und Ärzte aus Tunesien die Lücken schließen, die durch die Abwanderung hochqualifizierter Arbeitskräfte gerissen worden sind. Energiemonopolist Escom, dem scharenweise die Experten davongelaufen sind, sucht auf dem internationalen Mark verzweifelt nach Ersatz. Unter anderem sollen 200 in Ruhestand befindliche deutsche Techniker angeworben werden, um in der Provinz Ost-Kap die maroden Kraftwerke wieder auf Vordermann zu bringen. Die frühere Frau Nelson Mandelas, Winnie Mandela, sagt angesichts des wirtschaftlichen und sozialen Desasters ihres Landes: "Die Realität beginnt, uns einzuholen."
Magisches Datum 2010
Doch selbst der schärfste Kritiker von Staatspräsident Thabo Mbeki, sein Bruder Moeletsi, entwirft noch immer eine positive Zukunftsperspektive für Südafrika. Eine Präsidentschaft Jacob Zuma könne durchaus eine Wendung zum Besseren bringen, "weil die gegenwärtige Regierung keine gute Wirtschaftspolitik macht".
Der Unternehmer und politische Analytiker setzt auf die Stärken und das Potenzial seines Landes: Seinen Rohstoffreichtum, seine diversifizierte und erfolgreiche Wirtschaft, seine touristische Attraktivität, die funktionierende Demokratie mit einem funktionierenden Rechtssystem, die Unabhängigkeit der Medien und eine lebendigen Opposition, die Weltklasse-Universitäten und Forschungseinrichtungen.
Moeletsi Mbekis Hoffnungen ruhen aber vor allem auf der Zivilgesellschaft Südafrikas, die in den Mai-Unruhen ihre Stärke gezeigt habe, "indem sie den Job übernahm, den eigentlich die Regierung hätte machen müssen".
Alle Hoffnungen richten sich nun auf die Fußball-Weltmeisterschaft 2010. Wie eine magische Zahl ist dieses Datum. Auch Susan B. will erst mal abwarten. Die junge Deutsche ist vor drei Jahren ans Kap gekommen. Sie sagt: "Natürlich ist alles teurer geworden, natürlich macht mir die Kriminalität Angst. Aber ich laufe nicht einfach davon. Dazu ist dieses Land zu schön, dafür sind auch seine Menschen zu liebenswert."